„Wir sollten wachsam sein“

Anfang 2017 sorgte eine Kunstaktion des deutsch-israelischen Satirikers Shahak Shapira für heftige Kontroversen in den sozialen Medien: Im Web kursierende Selfies von Besucherinnen und Besuchern, die das Holocaust-Mahnmal in Berlin als Kulisse für ihre Profilfotos verwendet hatten, kombinierte der Künstler mit historischem Bildmaterial aus Vernichtungslagern. In den Fotocollagen auf „Yolocaust“ jonglieren Touristen vor Skeletten oder hüpfen auf Leichenbergen. Mit dieser Aktion wollte Shapira „die Menschen zum Nachdenken bringen, worum es bei dem Mahnmal geht“. Auch wenn Peter Eisenman, der Architekt der Gedenkstätte, sein Werk als keinen heiligen Ort bezeichnet hat, wo „Menschen im Feld picknicken und Kinder fangen spielen werden“, so ist der Umgang mit dem Denkmal für die ermordeten Juden Europas doch irritierend. „Das Projekt fand ich gut“, sagt der Zeithistoriker Dirk Rupnow, „die Leute verbinden mit Mahnmalen oft nichts mehr. Für Studierende in den Proseminaren heute ist der Holocaust so weit weg wie das Mittelalter. Sie haben wenig konkretes Wissen, aber gleichzeitig ein Übersättigungsgefühl und glauben, schon alles zu wissen. Das ist ein Problem“, analysiert der Dekan der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Innsbruck.
Politische Irritationen
Der Historiker war 2017 gerade als Gastprofessor an der US-amerikanischen Stanford University, als Präsident Donald Trump inauguriert wurde und kurz danach mit zahlreichen Aussagen für politische Irritationen sorgte – auch über das Gedenken an die Opfer des Holocaust. So kündigte Trump am 27. Jänner, genau jenem Tag, an dem weltweit der Opfer des Holocaust gedacht wird, seine restriktive Einreise- und Flüchtlingspolitik an. Über die sechs Millionen ermordeten Jüdinnen und Juden verlor das Weiße Haus am gleichen Tag im Statement zum Holocaust Remembrance Day kein Wort. Wenige Monate später erregte er Aufsehen mit einem sehr kurzen Besuch der bedeutenden israelischen Gedenkstätte Yad Vashem und einem unpassenden Eintrag in das Gedenkbuch. Er schrieb: It is a great honor to be here with all of my friends – so amazing + will never forget. „Das schreibt man, wenn man oben auf der Zugspitze steht und die Landschaft bewundert“, kommentierte Moshe Zimmermann, emeritierter Professor der Hebräischen Universität in Jerusalem, diesen Eintrag.
Erinnerungskultur zwischen Vergessen …
Für Dirk Rupnow sind diese Beispiele Anlass, sich mit aktuellen Entwicklungen in der Erinnerungskultur auseinander zu setzen. „Der Holocaust ist das einzige historische Ereignis, dessen Erinnerung nicht nur in einzelnen Ländern, sondern auf europäischer und globaler Ebene institutionell abgesichert ist“, sagt er. In den vergangenen zwanzig Jahren seien Standards definiert worden, wie dieses Gedenken aussehen muss und wie es jüngeren Generationen vermittelt werden sollte. Damit verbunden sei auch der Versuch, diese Erinnerung inhaltlich einheitlich auszugestalten. Das Spannungsfeld, in dem sich die Erinnerungskultur befindet, sieht Rupnow darin, dass der Holocaust immer mehr in die Vergangenheit rücke, vom Heute isoliert und gleichzeitig politisch instrumentalisiert werde.
„Die Holocaust-Erinnerung dient aktuell dazu, erneut Gruppen aus der Gesellschaft auszuschließen.“
… und politischer Instrumentalisierung
„Die einen benutzen die Erinnerung an den Holocaust dazu, einen menschlicheren Umgang mit Flüchtlingen einzuklagen, indem sie Flüchtlingslager mit KZs vergleichen. Andere argumentieren – und das ist fatal –, dass es sich beim Großteil der Flüchtlinge um Antisemiten handle, die man als Lehre aus dem Holocaust nicht nach Europa lassen dürfe – grad so, als ob es keinen einheimischen Antisemitismus mehr gäbe. Damit dient die Holocaust-Erinnerung dazu, erneut Gruppen aus der Gesellschaft auszuschließen. Das ist besorgniserregend“, sagt der Zeithistoriker.
Erinnern, um rechtzeitig Entwicklungen zu erkennen
Laut Rupnow hat das Erinnern die wichtige Aufgabe, bestimmte Strukturen, die es bereits in der Geschichte gab, rechtzeitig zu erkennen – das bedinge eine Verbindung zum Heute aber ohne direkte Vergleiche. „Historiker vergleichen nie in dem Sinne, dass etwas ident ist, sondern um ein Verständnis für bestimmte Situationen zu bekommen, etwa in denen sich – wie heute – plötzlich Stimmungen drehen und Ausschlüsse aus der Gesellschaft begründet werden“, erläutert der Wissenschaftler und nennt als aktuelles Beispiel den Aufstieg des Rechtspopulismus in Europa und weltweit.
Von Berlin …
Aufgewachsen in Berlin (West) studierte er zunächst in seiner Heimatstadt Geschichte, Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte. Dass er sein Studium ein Jahr später begann als ursprünglich geplant, hatte einen historisch bedeutenden Hintergrund: 1989 fiel die Berliner Mauer. „Das Leben mit der Mauer war für meine Generation Normalität, wir wussten, dass wir nicht einfach schnell rausfahren konnten“, erinnert sich der heute 46-Jährige an das Leben davor. West-Berliner mussten auch keinen Präsenzdienst leisten. Mit dem Mauerfall änderte sich das. So machte Rupnow plötzlich und unerwartet Zivildienst in einem Berliner Krankenhaus. „Ich war der Erste dort. Die wussten gar nicht, wie sie mich einsetzen sollten“, erzählt er. Dass sich für ihn damals auch die rege Ost-Berliner Theater- und Musikszene öffnete, schätzte er sehr.

… nach Wien
Die Begeisterung für Theater und Oper war ein wichtiger Grund, weshalb sich der junge Student bei der Wahl seines Erasmus-Jahres 1996 für Wien entschied. „Am Abend traf man mich entweder im Burgtheater, im Musikverein oder in der Staatsoper“, lächelt er. Geplant war ein Jahr, geblieben ist er viele. Nach seiner Sponsion in Wien war Dirk Rupnow 1999 wissenschaftlicher Mitarbeiter der Historikerkommission der Republik Österreich. Auf die Promotion 2002 an der Universität Klagenfurt folgten unter anderem Gastaufenthalte an der Duke University in North Carolina, dem Simon-Dubnow-Institut für jüdische Geschichte und Kultur an der Universität Leipzig sowie dem Center for Advanced Holocaust Studies des US Holocaust Memorial Museums in Washington, DC. 2009 habilitierte sich Rupnow in Wien und ging im selben Jahr an das Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck. „Letztlich waren es viele Zufälle, die meine Karriere ergeben haben“, resümiert er.
„Migration kam in der österreichischen Zeitgeschichte nicht vor.“
Migrationsforschung neu im Fokus
In Innsbruck verlagerte sich der Forschungsfokus des Historikers stärker in Richtung Diversität und Migration. Er etablierte Migrationsgeschichte als neuen Forschungsschwerpunkt am dortigen Institut für Zeitgeschichte und gründete 2015 das „Forschungszentrum Migration & Globalisierung“, das eine fächer- und Fakultäten übergreifende Arbeitsgruppe von Kolleginnen und Kollegen bündelt, die sich an der Universität Innsbruck aus verschiedenen Blickwinkeln wie der Europäischen Ethnologie, der Politologie, der Architektur, der Philosophie und der Pädagogik mit dem Thema Migration beschäftigen.
„Sichtbarkeit in der Geschichte ist die Grundlage für gesellschaftliche Akzeptanz.“
Migrationsgesellschaft Österreich
Vor einem Jahr schloss Dirk Rupnow das vom FWF finanzierte Projekt „Deprovincializing Contemporary Austrian History. Migration and the transnational challenges to national historiographies” ab. „Migration kam als Bestandteil der österreichischen Republikgeschichte praktisch nicht vor”, nennt der Historiker den Ausgangspunkt dieses Projektes, aber „Sichtbarkeit in der Geschichte ist eine wichtige Grundlage für gesellschaftliche Akzeptanz“. Diese Arbeit fokussierte auf die sogenannte Gastarbeitermigration der 1960er und 1970er Jahre, eine Zeit, die Rupnow als „Turning-Point“ der österreichischen Geschichte bezeichnet – wurde Österreich damals statistisch doch zu einem Einwanderungsland.
Mühsame Suche nach Quellen
Wichtig war Dirk Rupnow dabei ein transnationaler Blick, der über Österreich hinausgeht. In mühsamer Kleinarbeit ging er mit seinem sechsköpfigen Team auf die Suche nach Quellen. Eine Suche, die sich auch in Österreich als sehr schwierig herausstellte. Wenig Material war erhalten: „Man ist davon ausgegangen, dass die Gastarbeiter das Land wieder verlassen werden und sah oft gar keine Notwendigkeit, Akten aufzuheben“, erklärt sich Rupnow diesen Befund. In den Herkunftsländern – vor allem Ex-Jugoslawien und der Türkei – haben die Forscherinnen und Forscher versucht, Akten zu finden, die die Interessen und Perspektiven der Entsendeländer im Rahmen der Anwerbeabkommen und der Anwerbung sichtbar machen. Auch dort war vieles verschwunden oder wurde zerstört. „Die Suche nach Quellen ist hoch kompliziert. Manchmal hat man Glück, manchmal nicht“, erzählt er.
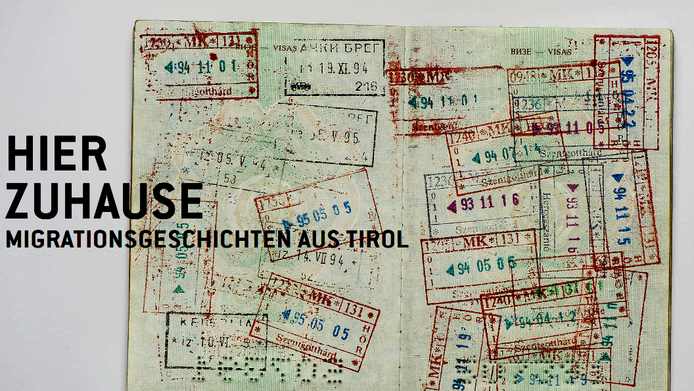
Migrationsarchiv als kollektives Gedächtnis
Aus diesem FWF-Projekt entwickelte sich für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Forderung nach einem „Archiv der Migration“ als Grundlage für ein verändertes kollektives Gedächtnis. Mittlerweile gibt es in vielen Bundesländern Einrichtungen, die Materialien und Dokumente zur Migrationsgeschichte archivieren. Ein gutes Beispiel ist Tirol, wo die Universität Innsbruck gemeinsam mit regionalen Partnern wie dem „Zentrum für MigrantInnen in Tirol“ und dem Landesmuseum ein Dokumentationsarchiv aufbaut, dessen Sammlungen öffentlich zugänglich sind. „Das FWF-Projekt hat eine gute Plattform geboten, Bewusstsein für die Notwendigkeit eines solchen Archives zu schaffen“, resümiert Rupnow. Die Ergebnisse flossen auch in unterschiedlichste Vermittlungsprojekte ein, etwa in eine Ausstellung im Volkskunstmuseum Tirol („Hier zuhause“ 2017) oder in die Ausstellung „Geteilte Geschichte. Viyana – Beč – Wien“, die bis Februar 2018 im Wien Museum gelaufen ist.
Migration und Diversität bleiben große Themen
Das abgeschlossene Grundlagenprojekt mit dem Fokus auf die Gastarbeitermigration sieht Rupnow nur als Anfang: „Wie sich die österreichische Gesellschaft durch Migration verändert, bleibt für die Zeitgeschichte in den nächsten Jahren ein riesiges Thema: Wie prägt und verändert Migration die Gesellschaft? Wie ändert sich der Blick auf die Vergangenheit, die weiter zurückliegt, wie zum Beispiel NS-Zeit und Holocaust, durch Diversität in der Gesellschaft? Und wie interpretieren wir diese Geschichten vor dem Hintergrund unserer heutigen Erfahrungen? Das sind die großen Themen der nächsten Jahre.“
„Wir lassen uns von der Politik nicht vereinnahmen.“
Positionierung gegen den Mainstream
Sieht er sich als Wissenschaftler in beratender Funktion der Politik gegenüber? „Wir sind froh, wenn unsere Expertise nachgefragt wird. Aber für uns ist immer ganz zentral, dass wir uns nicht vereinnahmen lassen. Im Sinne einer kritischen Migrationsforschung sehen wir es als unsere Aufgabe, auch unbequemen Positionen eine Öffentlichkeit zu verschaffen und uns gegen den Mainstream zu positionieren“, erläutert Rupnow. Gleichzeitig sieht er sich auch der Erwartungshaltung gegenüber, als Wissenschaftler gesellschaftliche Probleme zu lösen. Dieses komplexe und schwer zu navigierende Feld hat den Forscher schon immer beschäftigt, gerade auch weil er an Themen arbeitet, die öffentlich hoch relevant sind. „Wir führen am Institut in Innsbruck zum Beispiel auch viele regionale Projekte zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit durch, gerade etwa zu Zwangssterilisationen in der NS-Zeit, oder aber auch zu kritischen Aspekten der Nachkriegsgeschichte, etwa der Heimerziehung, die teilweise politisch gewollt und kommissionell abgewickelt werden.“ Die Frage, wie man sich in diesen Kontexten positioniere – auch im Zusammenhang mit Fördergeldern – sei für ihn als Wissenschaftler immer präsent.
Abwertung von Wissenschaft
Was die Rolle der Wissenschaft anbelangt, verfolgt Rupnow aktuelle Entwicklungen mit großer Besorgnis. „Die Abwertung von Wissenschaft und das Aufwerten von Gerüchten als „stichhaltig“, die gleichzeitige Etablierung von „alternativen Wahrheiten“ sowie das Eliten- und Wissenschaftsbashing von Trump – das kennen wir auch aus Europa. Da ist im Moment einiges in Bewegung, und wir alle im Wissenschaftsbetrieb sollten wachsam sein“, warnt der Forscher.
Zur Person
Der Historiker Dirk Rupnow ist seit März 2018 Dekan der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Innsbruck. Davor war er ab 2010 Leiter des Instituts für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck sowie Gründer und Leiter des Forschungszentrums „Migration & Globalisierung“ und des Doktoratskollegs „Dynamiken von Ungleichheit und Differenz im Zeitalter der Globalisierung“. Seine Forschungsschwerpunkte sind die europäische Geschichte des 20. und 21. Jahrhunderts, Holocaust- und Jüdische Studien, Wissenschafts- und Migrationsgeschichte, Erinnerungskulturen, Museologie und Geschichtspolitik. Der gebürtige Berliner studierte Geschichte, Germanistik, Kunstgeschichte und Philosophie in Berlin und Wien. Er arbeitete für die Historikerkommission der Republik Österreich und absolvierte zahlreiche Forschungsaufenthalte unter anderem an der Duke University in North Carolina, dem Simon-Dubnow-Institut für jüdische Geschichte und Kultur an der Universität Leipzig sowie dem Center for Advanced Holocaust Studies in Washington. 2017 war Rupnow "Distinguished Visiting Austrian Chair Professor" an der Stanford University.





