Mit Nasenspray gegen den Drogentod

Oscargewinner Philip Seymour Hoffmann, Pop-Legende Prince, US-Musiker Tom Petty, drei Größen aus dem Showbusiness mit der gleichen Todesursache: Sie starben an einer Überdosis an opioidhaltigen Schmerzmitteln. Ein Problem, das nicht nur die Musik- und Filmbranche betrifft, sondern alle Schichten der amerikanischen Gesellschaft.
Schmerzmittel als Einstiegsdroge
Am Anfang stehen nicht selten eine Sportverletzung, ein schmerzender Zahn oder Rückenprobleme. Der Arzt verschreibt ein Opioid haltiges Schmerzmittel, das rasch Linderung verschafft – und abhängig macht. Ein scheinbar harmloser Einstieg in die Drogensucht. US-Behörden schätzen die Zahl der Opioid-Abhängigen im Land auf über zwei Millionen. Die Zahl der Drogentoten betrug laut US-Gesundheitsbehörde CDC 2019 rund 71.000. Fast 200 Menschen sterben in den USA täglich an einer Überdosis an Opioiden – dazu zählen Heroin, Methadon, Fentanyl sowie verschreibungspflichtige Schmerzmittel. Die Opioid-Epidemie ist mittlerweile die häufigste Todesursache bei Amerikanerinnen und Amerikanern unter 50 Jahren.
Am Anfang stand die Wunderpille
Die erste Welle der Opioid-Krise begann 1996 als der US-Konzern Purdue Pharma das verschreibungspflichtige Schmerzmittel Oxycontin auf den Markt brachte und jahrelang als völlig unbedenklich vermarktete. Mit diesem Medikament gab es für viele Schmerzpatientinnen und -patienten schnelle, scheinbar harmlose Linderung. Auch für die Krankenversicherungen waren diese Mittel attraktiv, da sie günstiger als langfristige Therapien waren. Die aggressive Vermarktung der angeblichen Wunderpille durch die Hersteller und die Verschreibungsfreude der Ärzte führten in der Folge zwischen 1991 und 2011 zu einer Verdreifachung der verschriebenen Schmerzmittel in den USA von 76 Millionen auf 219 Millionen pro Jahr. Mit verheerenden Folgen. Denn die enthaltenen synthetischen Opioide wirken nicht nur gegen Beschwerden wie Schmerzen und Angstzustände, sondern machen sehr schnell abhängig.
Von der Schmerztablette zu Heroin und Fentanyl
Als die Verschreibungspraxis rigoroser wurde und die Tabletten am Schwarzmarkt zu teuer wurden, stiegen viele Menschen mit Suchterkrankung auf das billigere halbsynthetische Heroin um, und in den vergangenen Jahren verstärkt auf das vollsynthetisch hergestellte Fentanyl. Mit fatalen Folgen: Fentanyl ist 50 bis 100 Mal stärker als Morphin, was das Risiko einer tödlichen Überdosis durch Atemstillstand erhöht. Da die Herstellung von Fentanyl relativ einfach ist und Dealer durch die hohe Potenz mit vergleichsweise geringen Mengen hohe Gewinne lukrieren können, wird der Stoff auch Kokain und Methamphetaminen zugemischt. So sind sich Drogenkonsumenten mitunter gar nicht bewusst, dass sie Gefahr laufen, Opfer einer Überdosis zu werden. Berühmtes und trauriges Beispiel: der US-Musiker Prince starb 2016 an einer versehentlichen Überdosis Fentanyl.
Nationaler Notstand
Nachdem 2013 Fentanyl seinen unheilvollen Siegeszug auf dem US-amerikanischen Drogenmarkt begonnen hatte, stieg die Zahl der Überdosis-Toten in den folgenden Jahren weiter an. Die Opioidkrise nahm ein solches Ausmaß an, dass Präsident Donald Trump im Oktober 2017 den medizinischen nationalen Notstand ausrief: In dem Jahr starben 47.000 Menschen an den Folgen einer Opioid-Überdosis, umgerechnet 130 täglich.
Naloxon gegen Überdosis
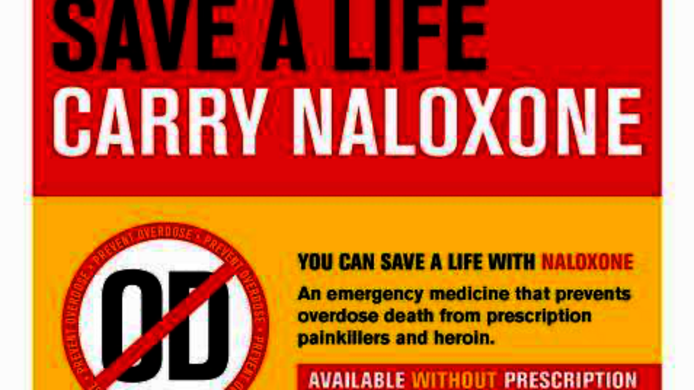
Ein Mittel, das in der Notfallmedizin bei Opioidüberdosierung angewandt wird, ist Naloxon. Als Opioid-Antagonist blockiert Naloxon die Opiat-Rezeptoren im Gehirn. 1961 in New York patentiert, wird es seit 1971 eingesetzt. Bei Atemstillstand wirkt es intravenös, intramuskulär oder als Nasenspray in wenigen Sekunden, hebt die Wirkung von Opioiden kurzfristig auf und verhindert so eine Schädigung des zentralen Nervensystems und den Tod.
Training zum Lebensretter
2005 begann man in einigen US-Städten – federführend in New York City – Naloxon-Kits gratis als Erste-Hilfe-Maßnahme, begleitet von Trainings, an die Bevölkerung auszugeben. Jeder der möchte kann ein Training machen, erhält ein Naloxon-Kit und wird so im Notfall zum Lebensretter. An diesen Trainings nehmen neben Menschen, die selbst von einer Suchterkrankung betroffen sind, auch deren Angehörige, Polizistinnen und Polizisten, Supermarktbedienstete und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Suchthilfeorganisationen teil.
Helden des Alltags
„Fast alle hier in New York, die Opioide konsumieren, wissen, was Naloxon ist und ich schätze, dass 70 Prozent ein Training und ein Naloxon-Kit erhalten haben“, sagt Laura Brandt. Die Psychologin der Universität Wien erforscht, wie wirkungsvoll diese Präventionsprogramme sind und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen. Seit Februar 2019 ist sie deshalb im Rahmen eines Erwin-Schrödinger-Auslandsstipendiums des Wissenschaftsfonds FWF an der Columbia University in New York. Sowohl das Wissen über Überdosisprävention als auch die Akzeptanz des Programms seien sehr hoch. Das liegt nicht zuletzt daran, wie diese Maßnahme kommuniziert wird. „Von der Allgemeinbevölkerung wird es als ein Selbstwirksamkeitsmoment erlebt, im Notfall helfen zu können. Das NYC Department of Health kommuniziert das auch so: Du bist die Heldin, der Held des Alltags“, erzählt Brandt, die im Heldenepos etwas Ur-Amerikanisches sieht. „Der Heldenstatus und Werbung machen zu können sind eingebettet in die amerikanische Kultur.“
„Sie werden in New York City kaum jemanden auf der Straße treffen, der Naloxon nicht kennt.“
Wann ist ein Interventionsprogramm erfolgreich?
Für die Organisationen, die diese Trainings anbieten, gibt es gut standardisierte Trainingsprotokolle. Diese Protokolle sind wissenschaftlich entwickelt und die Maßnahmen im Labor getestet. Doch nicht immer funktionieren sie in der Praxis. Herauszufinden woran das liegt, genau damit beschäftigt sich die Implementationsforschung. Die 35-Jährige nennt es, „in die Black Box schauen“. Nach Brandts Erfahrung hängt der Erfolg von zwei Faktoren ab: einerseits von der Interventionstreue, das heißt, ob sich die Trainerinnen und Trainer an das Protokoll halten und andererseits von der Akzeptanz, also ob sowohl Trainer und Trainerinnen als auch Trainierte die Schulung für sinnvoll und wichtig erachten. „Wenn Sie das bei der Implementierung von Interventionsprogrammen ignorieren, werden Sie sich immer fragen müssen, warum funktioniert es nicht“, sagt Brandt.
Die ersten Schritte im Notfall
Mit gerade einmal vier Seiten ist das Naloxon-Trainingsprotokoll kurz und simpel gehalten und erleichtert damit sowohl die Anwendung als auch die Evaluierung. Der erste Teil des Trainings beschäftigt sich mit der Frage, woran man eine Überdosis erkennt. Todesursache ist Atemstillstand und dieser ist relativ leicht zu erkennen: keine Atmung, blaue Lippen, blaue Fingernägel. Aber selbst wenn der Mensch, der am Boden liegt, einen Herzinfarkt hatte, kann man mit Naloxon nichts falsch machen, denn es wirkt nur auf die Opiatrezeptoren. Sind keine derartigen Substanzen im Körper, hat Naloxon einfach keine Wirkung. Sieht man also jemanden, an dem man Anzeichen einer Überdosis erkennt, soll man den Notruf wählen und mit Naloxon Erste Hilfe leisten. Essenziell dabei ist ein Gesetz, nach dem Ersthelfende, die Drogen bei sich haben, nicht dafür belangt werden können. „Niemand ruft 911 wenn er Angst haben muss, verhaftet zu werden“, sagt die Psychologin.

Train-the-Trainer-Programm
Zum Trainer ausbilden lassen kann man sich in einem zweistündigen Train-the-Trainer-Programm des NYC Department of Health. Diese Trainings bieten zusätzlich Hintergrundinformationen und befugen die Absolventinnen und Absolventen selbst Trainings zu veranstalten und Naloxon auszugeben. „Dieses Programm ist sehr gut implementiert, simpel und realistisch gehalten und verursacht geringe Kosten für die Organisationen“, beurteilt Brandt die Präventionsarbeit der New Yorker Gesundheitsbehörde.
Feldforschung
New York suchte sich Brandt als Forschungsort aus, weil man hier bereits über 15 Jahre Erfahrung verfügt. Die ersten Ergebnisse ihrer Arbeit zeigen, dass es den Organisationen gut gelungen ist, das Präventionsprogramm zu etablieren, denn sowohl die Interventionstreue als auch die Akzeptanz seien sehr hoch. Der erste Schritt ihrer Forschung ist, das Vertrauen der Organisationen zu gewinnen, um sich im Haus bewegen und den Leuten bei der Arbeit zuschauen zu können. „Als Doppelfremde – Wissenschaftlerin und Deutsche/Österreicherin – brauchte das schon ein paar Treffen, bis man eingelassen wird“, sagt sie. Ist der erste Schritt geschafft, führt die Psychologin ausführliche Interviews mit den Leitenden der Naloxon-Programme um zu erfahren, wie die Pläne anfangs waren, welche Änderungen es gab und welche Unterstützung die Trainierenden aber auch die Organisationen selbst erhalten. Dann folgt die Datenerhebung, wo Faktoren wie Wissensgewinn und Akzeptanz untersucht werden.
Corona-Hotspot New York City
Genau in dieser Phase war die Wissenschaftlerin Anfang März diesen Jahres als der coronabedingte Shutdown kam und sie ins Homeoffice geschickt wurde. New York war im Frühjahr der Corona-Hotspot der USA, die Zahl der Infektionen und Todesfälle stieg rasant an. „Für mich war der schlimmste Moment, als in der Innenstadt Zelte aufgestellt wurden, um die Leichen darin unterzubringen, für die kein Platz mehr war und es Diskussionen gab, ob in Parks vorübergehend Gräber ausgehoben werden sollten“, erinnert sich Brandt an den Moment, als die Stadt den Atem anhielt.
„New York City ist vermutlich weltweit am nächsten an der Herdenimmunität.“
Herdenimmunität in New York City?
Ob ein schnelleres Handeln seitens der Politik Corona-Tote verhindert hätte, wagt die gebürtige Heidelbergerin nicht einzuschätzen, denn man wisse immer noch zu wenig über Covid-19. Außerdem müsse man die Größenordnungen im Auge behalten: „Die Einwohnerzahl New York Citys entspricht der ganz Österreichs. Die USA sind nicht nur sehr groß, sondern auch regional sehr unterschiedlich. In New Jersey, wohin ich vor kurzem übersiedelt bin, tragen alle brav die Maske. In Washington Heights auch, aber am Kinn“, schmunzelt sie. „Aufgrund der Bevölkerungsdichte von New York City ist es unmöglich, effiziente Distanzierungsmaßnahmen einzuführen.“ Da es einen klaren Peak und danach einen klaren Abfall der Infektionen gab, hegt Brandt eine Theorie: „New York City ist vermutlich weltweit am nächsten an der Herdenimmunität.“
Maske tragen für die Heldinnen und Helden
Auch wenn es in den USA Proteste gegen die Maßnahmen zur Eindämmung von Corona gab, konnten doch viele zur Einhaltung motiviert werden. In der Art, wie das erfolgt, sieht Brandt einen großen Unterschied zu Europa. „Menschen die an der Basis arbeiten, wie im Gesundheitswesen oder der Müllabfuhr, haben Heldenstatus erworben. Die Menschen sagen sich: Für diese Heldinnen und Helden trage ich die Maske und wasche ich mir die Hände. Hier können Sie nicht sagen, ihr habt euch jetzt daran zu halten. Der Outcome ist zwar derselbe aber die Motivation eine völlig andere“, schildert die Psychologin die kulturellen Unterschiede. Es ist genau dieser Heldenstatus, den man auch erwirbt, wenn man jemanden vor dem Überdosistod rettet.
„Menschen, die an der Basis arbeiten, haben Heldenstatus erworben.“
Effekt des Lockdown auf die Präventionsarbeit
Als der Lockdown kam, hatte Brandt bereits einen Großteil der Daten erhoben, doch mit den unerwarteten Ereignissen sind neue Fragen aufgetaucht. Die Wissenschaftlerin hat vor, in einer Substudie zu untersuchen, wie sich der Lockdown auf die Präventionsprogramme ausgewirkt hat. Zum einen konnten die Programme nicht wie bisher weiterlaufen und zum anderen hat sich der Drogenkonsum verändert, da die Menschen nehmen mussten, wozu sie Zugang hatten. „Das kann dazu führen, dass mehr Drogen genommen werden, die mit Fentanyl versetzt sind, was das Risiko einer Überdosis erhöht“, sagt Brandt. Ein anderer Effekt des Lockdown, den sie in Befragungen erfahren hat: Menschen mit Suchterkrankungen erlebten die Isolation auch als hilfreich, weil zum einen der Druck abfiel, sich sozial integrieren zu müssen und zum anderen alle Ärzte online zu erreichen waren. Ihr Forschungsaufenthalt würde planmäßig im Februar 2021 enden. Doch um all den neuen Fragen nachgehen zu können, möchte Brandt verlängern: „Ich glaube, das ist ein wichtiger Moment, von dem wir sowohl in den USA als auch in Österreich viel lernen können.“
„Wir können uns von den USA abschauen, wie man Maßnahmen gut kommuniziert.“
Synergien mit Suchthilfeprojekt in Graz
Wenn Brandt nach Wien zurückkehrt, möchte sie ihre Erfahrungen in einem Grazer Suchthilfe-Pilotprojekt, dem Kontaktladen der Caritas, einbringen. „Die Synergien sind hochaushoch! Die Protokolle aus New York sind sehr gut in Österreich einsetzbar und wir können meine Erfahrung aus den USA und jenen in Graz zusammenbringen“, sagt sie. Was wir hier auf alle Fälle von den Amerikanern lernen können, sei das Marketing. „Wir sollten uns abschauen, wie man Maßnahmen gut kommuniziert, dass man auch jemanden erreicht, der sich nicht von vornherein für das Thema interessiert. Sie werden in New York City kaum jemanden auf der Straße treffen, der Naloxon nicht kennt.“
Zur Person
Die Psychologin Laura Brandt ist zurzeit mit einem Erwin-Schrödinger-Stipendium des Wissenschaftsfonds FWF am Department of Psychiatry an der Columbia University in New York. Die gebürtige Deutsche studierte Psychologie an der Universität Wien und promovierte in Angewandter Medizinwissenschaft an der Medizinischen Universität Wien. Sie arbeitete im klinischen Bereich im Geriatriezentrum Wienerwald und im Schweizer Haus Hadersdorf, einer Einrichtung für stationäre und ambulante Therapie für Suchterkrankungen. Ihre Hauptforschungsgebiete sind Studien zu Substanzkonsumstörungen und deren Begleiterkrankungen, Opioid-Ersatztherapien, speziell bei schwangeren Frauen, sowie sozio-ökonomische/politische und genderspezifische Aspekte von Suchterkrankungen. Sie nimmt dabei eine Implementationsperspektive ein, um langfristig zur Verbesserung der Suchtbehandlung und zu „Harm Reduction“-Ansätzen (wie der Bereitstellung von Naloxon) beizutragen.





