Der Mensch, das Unberechenbare in der Simulation
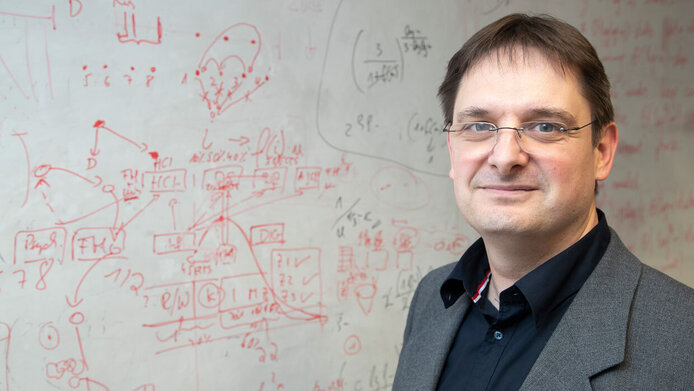
Ob in der Klima- und Verkehrsforschung oder, wie seit einem Jahr, in der Bekämpfung einer globalen Pandemie – Computersimulationen sind heute nicht mehr wegzudenken. Die Welt ist zu komplex geworden, als dass man noch ohne die enorme Rechenleistung von Computern auskommen könnte. In der Coronapandemie rückte die Arbeit jener Forscherinnen und Forscher, die sich auf dieses Feld spezialisiert haben, in den Fokus der breiten Öffentlichkeit. Auch in den Medien sind sie mittlerweile häufig geladene Gäste. Kein Wunder, denn ihre Simulationen bilden eine wichtige Grundlage für politische Entscheidungen wie Lockerungen oder Verschärfungen von Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Der Mathematiker und Informatiker an der Universität Salzburg Robert Elsässer gehört zu jenen, die berechnen, welche Maßnahmen sich wie auf das Infektionsgeschehen auswirken.
Viren verhalten sich wie Informationen
Robert Elsässer und sein Team beschäftigen sich seit etlichen Jahren mit der Ausbreitung von Krankheiten in großen Populationen. Als Experte für Algorithmen entwickelt er Verfahren, um Verteilungsprobleme in dynamischen Systemen zu lösen. Ein fundamentales Problem in großen Netzwerken ist die Verteilung von Informationen. Hier besteht eine erstaunliche Parallele: oft verbreiten sich Viren in einer Population ähnlich wie Informationen in einem Netzwerk. Diesen Umstand kann sich die Wissenschaft im Kampf gegen die Pandemie zunutze machen. Bereits 2004 hat das Team um Elsässer mit der Erforschung der Verbreitung von grippeähnlichen Prozessen begonnen, die erstaunliche Ähnlichkeiten zu den realmedizinischen Daten des Robert-Koch-Instituts aufweisen. Als vor einem Jahr Covid-19 aufkam, konnten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diese Erkenntnisse ihrer Arbeit zugrunde legen, mussten dabei ein paar Anpassungen – wie etwa zusätzliche Infektionsarten – durchführen und konnten rasch erste Daten zur Verfügung stellen.
Grundlagenforschung – Basis für rasche Ergebnisse in der Pandemie
Dieses Beispiel zeigt: Viele wissenschaftliche Entwicklungen in diesem Pandemiejahr schreiten nicht nur deshalb so schnell voran, weil Forschung und finanzielle Mittel sich darauf konzentrieren, sondern vor allem, weil die Grundlagenforschung seit Jahrzehnten den wissenschaftlichen Boden dafür bereitet. Der erste Impfstoff gegen Covid-19 wurde binnen weniger Monate nach Ausbreitung der Pandemie bereits Ende 2020 zugelassen. Doch die dahinterliegende Forschungsarbeit für solche mRNA-Impfstoffe dauerte Jahrzehnte und sollte ursprünglich ganz anderen Zielen als antiviralen Impfstoffen dienen – nämlich einer Krebsvakzine. Ein vielversprechendes Medikament gegen Covid-19 des Wiener Unternehmens Apeiron wird gerade klinisch getestet und zeigt gute Ergebnisse. Mit der Grundlagenforschung an der Entwicklung dieses antiviralen Medikaments hat der Apeiron-Gründer und Molekularbiologe Josef Penninger vor 20 Jahren begonnen.
Verschärfungen in Wien
Wie sieht nun der Simulationsexperte die derzeitige Situation in Wien? Für die erschöpfte Bevölkerung keimt im Frühling nach einem Jahr mit Social Distancing, Homeoffice, permanenter Betreuungsunsicherheit für Familien mit Kindern und existenziellen Sorgen neue Hoffnung auf. Noch am 21. März 2021 kündigt Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker an, trotz steigender Infektionszahlen die Wiener Schanigärten Ende März öffnen zu wollen. „Wir können die Bevölkerung nicht länger einsperren“, sagt er. Doch wie so oft in diesem Jahr der Pandemie kommt es anders. Die Intensivstationen der ostösterreichischen Spitäler sind am Anschlag, die Regierung zieht die Notbremse und beschließt zumindest für den Osten Österreichs Verschärfungen. Am 24. März werden die neuen Maßnahmen bekannt gegeben: unter anderem FFP2-Maskenpflicht in allen geschlossenen, öffentlichen Räumen, Testungen in Betrieben, mehr Homeoffice, Handelsschließung und eine Rückkehr aller Schülerinnen und Schüler ins Distance-Learning nach den Osterferien. Der harte Lockdown wird schließlich bis Anfang Mai verlängert.
Zur Person
Robert Elsässer ist Professor für Computerwissenschaften an der Universität Salzburg. Er studierte Informatik mit Nebenfach Mathematik an der Universität Paderborn/Deutschland, promovierte dort 2002 in Informatik und wurde zum Juniorprofessor ernannt. Nach einem Forschungsaufenthalt an der University of California in San Diego und Gastprofessuren in Bordeaux und Freiburg wurde Elsässer 2012 an die Universität Salzburg berufen. Dort leitet er die Efficient Algorithms Group. Seine Forschungsschwerpunkte sind parallele und verteilte Algorithmen sowie die Struktur von Graphen und Netzwerken.
„Mehr Testungen in Betrieben könnten die Infektionswelle brechen, vorausgesetzt die Quarantäne wird eingehalten. “
Wellenbrecher: Testungen in Betrieben
Einen entscheidenden Effekt erwartet sich Robert Elsässer durch die Forcierung von Homeoffice und die geplanten betrieblichen Testungen. „Die Testungen in den Betrieben finde ich sehr sinnvoll, wobei mehrmals wöchentlich getestet werden sollte, um entsprechende Wellenbildungen in kurzen Zeitabständen zu brechen“, stellt der Wissenschaftler Ende März fest. Hier könne man unterschiedliche Testvarianten kombinieren, zum Beispiel einmal in der Woche PCR-Gurgeltests und alle zwei Tage die weniger zuverlässigen Antigen-Schnelltests. Sein Team konnte den „Wellenbrecher-Effekt“ dieser Maßnahme in den Simulationen sehr deutlich erkennen – vorausgesetzt, die Quarantänebestimmungen werden konsequent eingehalten. Eine Ausdehnung der FFP2-Maskenpflicht auf Büros sieht Elsässer eher skeptisch: „Auf Dauer kann die Maske die Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer senken.“

Regionale Maßnahmen und Eintrittstests für Handel wenig sinnvoll
Für politisch verständlich, aber epidemiologisch nicht optimal erachtet der Simulationsexperte die regionale Beschränkung von Maßnahmen: „Es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis die Krankenhäuser in anderen Bundesländern an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen.“ Auch Eintrittstests für den Handel kann Elsässer wenig abgewinnen: Konsequentes Tragen der FFP2-Maske müsste hier ausreichen.
Übertragung in geschlossenen Räumen
Die Simulationen des Elsässer-Teams fokussieren auf die Übertragung von Viren in geschlossenen Räumen, konkret an Schulen, am Arbeitsplatz und in den Familien. Auch Expertinnen und Experten der deutschen Gesellschaft für Aerosolforschung (GAeF) empfahlen in einem Schreiben an die deutsche Bundesregierung Mitte April 2021, den Schwerpunkt auf Innenräume zu setzen, da dort die „allermeisten Infektionen“ stattfänden. Sie berufen sich dabei auf internationale Studien. Im Freien können Infektionen vorwiegend über Tröpfchen erfolgen – wovor Abstandhalten und die FFP2-Maske schützen.
Parameter: Homeoffice, Distance-Learning, Einhaltung der Quarantäne etc.
Die Daten für die Berechnungen des Salzburger Experten stammen aus der einschlägigen medizinischen Fachliteratur. Wichtige Parameter sind unter anderem der Anteil von Homeoffice, das Ausmaß von Distance-Learning, die Unterteilung von Büroräumen nach der Anzahl der darin Arbeitenden, die Einhaltung von Quarantänemaßnahmen und die Altersstruktur.
„Würden sich wirklich alle an die Maßnahmen halten, bräuchten wir keinen harten Lockdown.“
Als Datenbasis dienen Elsässer in erster Linie Details aus der Stadt Salzburg, allerdings zeigten sich keine großen Unterschiede zu gesamtösterreichischen Daten. Wichtig sei, dass man einen relativ geschlossenen Bereich untersucht, also beispielsweise einen städtischen Raum: „Unsere Simulationen eignen sich sehr gut für Städte wie Salzburg, Wien oder Linz und weniger gut für ländliche Regionen.“
Anfang Jänner: weicher Lockdown wirkt nicht
Die Ergebnisse der Berechnungen Anfang Jänner zeigten eindeutig: Bei normalem Schulbetrieb ohne Maßnahmen wie Testung und Schichtbetrieb und einer Homeoffice-Rate von 30 bis 60 Prozent ist selbst optimistisch gerechnet eine Steigerung der Infektionen nicht zu verhindern. Ein weicher Lockdown wirkt erst, wenn 40 Prozent der Bevölkerung bereits immun sind.
Maßnahmen von vor Ostern ausreichend, wenn sich alle daran hielten
Das Bild, das die neuesten Simulationen von Ende März zeigen, ist nicht mehr so eindeutig. Berücksichtigt sind die Virusmutationen mit einer um 25 bis 50 Prozent erhöhten Infektionswahrscheinlichkeit und jene Maßnahmen, wie sie vor Ostern galten, also Schulschichtbetrieb mit Testung, Handel und körpernahe Dienstleister unter bestimmten Abstandsregeln geöffnet. „Wenn wir von einem Schulbetrieb mit Testung ausgehen und davon, dass 50 Prozent der positiven Fälle bei Kindern entdeckt werden und diese gemeinsam mit ihren Familien in Quarantäne gehen – unter der Voraussetzung, dass sich alle an die Maßnahmen halten und Infektionen nur in Schulen, in Familien und in Betrieben erfolgen –, dann würden diese Maßnahmen selbst für die Virusmutation ausreichen“, sagt Elsässer. Das Problem: die vielen Wenns und Unbekannten.
Unbekannte: Grenzen des Modells
Denn halten sich nicht alle an die Regeln und kommt es auch nur zu einer geringfügigen mathematischen Abweichung von 0,02 Prozent von diesen Annahmen, steigen die Infektionszahlen in Folge wieder. Unbekannte im Geschehen bringen die mathematischen Modelle an ihre Grenzen. So ist es etwa erlaubt, dass sich zwei Haushalte treffen. Aber wie oft passiert das und wie viele Haushalte welcher Größe treffen sich? Das lässt sich in den Simulationen schwer abbilden. „Doch diese eine Unbekannte reicht für ein Ansteigen der Infektionen“, sagt der Informatiker.
Von der Ceausescu-Diktatur nach Deutschland
Mathematik ist schon in der Schule Elsässers Lieblingsfach. Aufgewachsen im rumänischen Siebenbürgen – seine Vorfahren waren Angehörige der Volksgruppe der Banater Schwaben - wandert er nach der Wende als 18-Jähriger nach Deutschland aus und studiert an der Universität von Paderborn Informatik mit Nebenfach Mathematik. Was er in seiner neuen Heimat bis heute besonders schätzt, ist die Meinungsfreiheit. Aufgewachsen in einem totalitären Regime, in dem schon ein Witz über die Regierung einem die Freiheit kosten kann, sieht der 49-Jährige in der Demokratie einen unschätzbaren Wert. „Ich bin heute noch fassungslos darüber, dass es überhaupt möglich ist, eine gesamte Bevölkerung dermaßen zu unterdrücken“, erinnert er sich an seine Kindheit in der neostalinistischen Diktatur unter Nicolae Ceausescu.
Schatten im Rampenlicht
Robert Elsässer gehört zu jenen Forschenden, die im Laufe der Coronapandemie ins Rampenlicht gerückt sind. Eine Erfahrung mit Licht- und Schattenseiten. Einerseits freut er sich über das allgemein gesteigerte Interesse an seiner Arbeit, die er seit Jahrzehnten verfolgt, und dass er damit zur Überwindung der Krise beitragen kann. Andererseits gibt es auch böse Kommentare auf Zeitungsinterviews und persönlich beleidigende Mails von Coronaleugnern. Corona – eine Zeit voller Widersprüchlichkeiten.





