Die soziale Fieberkurve von Corona
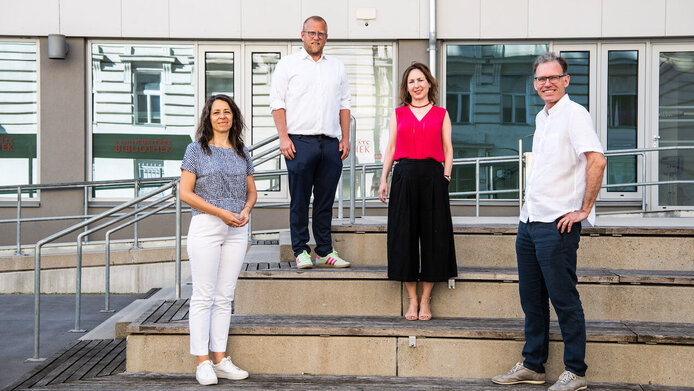
Am 25. Februar 2020 wird in Österreich erstmals das SARS-CoV-2-Virus nachgewiesen. Zwei Tage später spricht sich die Regierung in der Plenarsitzung des Nationalrats noch gegen jede Panikmache aus. Doch die Zahlen der Infektionen steigen national und international exponentiell an und die WHO stuft die Krise am 11. März als Pandemie ein. Einen Tag später beklagt Österreich seinen ersten Covid-19-Todesfall. Am 16. März verordnet die Bundesregierung den umfassenden Lockdown. Österreich sperrt zu. Hamsterkäufe vor der Schließung des Handels geben dem außergewöhnlichen Geschehen eine skurrile Note. Eine Pressekonferenz jagt die nächste. Aufnahmen aus dem italienischen Bergamo zeigen dramatische Szenen: Militärlaster transportieren im Konvoi mitten in der Nacht unzählige Särge durch menschenleere Straßen. Der Bundeskanzler befeuert dieses Bild und damit die Angst: „Wir werden auch in Österreich bald die Situation haben, dass jeder irgendjemanden kennt, der an Corona verstorben ist.“
Die österreichische Bevölkerung hält sich weitgehend an die vorgeschriebenen Beschränkungen und die Menschen geben sich gegenseitig Mut. Den braucht es auch angesichts des wirtschaftlichen Einbruchs: Im Mai erreicht die Arbeitslosigkeit mit 12 Prozent den Rekordwert seit 1945 und jeder dritte Beschäftigte ist in Kurzarbeit. Die Bundesregierung startet eine omnipräsente Kampagne: „Schau auf dich, bleib zu Hause. So schützen wir uns.“ Radio Wien spielt jeden Abend um 18 Uhr die inoffizielle Hymne „I am from Austria“ von Rainhard Fendrich. Sogar die Wiener Polizei beteiligt sich und verstärkt das Lied durch die Lautsprecher ihrer Einsatzwagen. Man steht zusammen und applaudiert den sogenannten Systemerhalterinnen und Systemerhaltern im Gesundheitssystem, dem Lebensmittelhandel, dem Lieferservice und der Müllabfuhr. Es ist eine Zeit der Angst, aber auch der Zuversicht auf ein baldiges Ende dieser Krise im Miteinander.
Krise als Chance
Der Zukunftsforscher Matthias Horx sieht in der Krise gar die Chance auf einen gesellschaftlichen Neubeginn. Manche hegen die Hoffnung, dass diese Pandemie eine Wende zu mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz einläuten könne. Und tatsächlich werden Effekte der gesellschaftlichen Vollbremsung sichtbar: Der bundesweite Gesamtverkehr sinkt um 23 Prozent, was sich auch messbar in verbesserter Luftqualität niederschlägt. Für Mai zeigen Studien eine Reduktion der globalen CO2-Emissionen von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert. Die weitgehende Einstellung des Verkehrs von Kreuzfahrtschiffen und Fähren verbessert vielerorts die Wasserqualität und im April 2020 wird aus Triest euphorisch gemeldet, dass sich seit vielen Jahren erstmals wieder Delfine im Hafenbecken tummeln. Schafft ein Virus das, was die unzähligen Warnungen der Klimaforschung bis dahin nicht geschafft haben?
Die gesellschaftliche Spaltung hat zugenommen
Heute, neun Monate und zwei Lockdowns später, ist von dieser Aufbruchstimmung nicht mehr viel zu spüren. „Die Hoffnungen haben sich zerschlagen“, sagt Bernhard Kittel. „Das gesellschaftliche Auseinanderdriften, das wir seit Jahren beobachten, wurde durch die Krise beschleunigt. Die Spaltung der Gesellschaft hat zugenommen, die Solidarität ist gesunken, ebenso das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung und die Demokratie“, lautet sein ernüchternder Befund. Belegen kann er diesen mit umfangreichen Daten.
Monatlich werden 1.500 Menschen befragt
Der Sozialwissenschaftler der Universität Wien untersucht gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen Sylvia Kritzinger, Barbara Prainsack und Hajo Boomgaarden und einem multidisziplinären Team Einstellungen, Verhalten und Reaktionen der in Österreich lebenden Menschen auf die Corona-Krise. Das Austrian Corona Panel zählt zu den größten sozialwissenschaftlichen Corona-Studien in Österreich – 1.500 Menschen werden monatlich befragt, um fundierte Daten zur Beantwortung vieler Fragen zu erhalten. Wie gehen Menschen mit der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Bedrohung um? Wie denken sie über die Pandemie und die Maßnahmen zur Überwindung der Krise? Welche Gruppen sind besonders stark betroffen? Ändert sich die Einstellung zu Demokratie und Rechtsstaat?
Dauer der Pandemie wurde unterschätzt
Mit der Bewilligung einer Akutförderung des FWF im Juli 2020 konnte die Studie, die mit einer Anschubfinanzierung des Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds WWTF Ende März bereits begonnen hatte, fortgeführt werden. Den Antrag auf die kurzfristige Ausschreibung des WWTF hat Kittel in einer Nacht geschrieben. „Dann haben wir zu fünft ein Wochenende lang durchgearbeitet und den ersten Fragebogen entworfen“, erinnert sich Kittel an den Anfang. Bereits zwei Wochen nach Ankündigung des ersten Lockdowns im März waren seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Feld. Die Dauer der Krise hatten allerdings auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschätzt. So lautete eine Frage in der ersten Erhebung, wie lange man dachte, dass die Krise dauere. Der höchste Wert zur Auswahl war „länger als 6 Monate“. Wenige Befragte schätzten die Dauer so lange ein.
Optimismus, dass es bald vorbei sein wird
In diesem Optimismus, dass es bald vorbei sein würde, sieht Kittel einen der Gründe für die hohe Zustimmung zu den Regierungsmaßnahmen seitens der Bevölkerung in den ersten Wochen. Ein Augen-zu-und-durch. Auch das Schreckensszenario, das der Bundeskanzler zeichnete, und die Bilder aus Norditalien spielten hier eine entscheidende Rolle. „Zudem erlebte unsere Generation etwas Neues, Geschichtsträchtiges“, beschreibt der Soziologe das Gefühl vieler im Frühjahr. Die Gefahr des Virus wurde ernst genommen und man hielt sich an die Maßnahmen, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen: um sich selbst zu schützen, um andere zu schützen, weil es eine klare soziale – aber auch gesetzliche – Norm ist.
Falsche Kommunikationsstrategie
Die Lockerungen zu Beginn des Sommers verbreiteten das Gefühl, es nun durchgestanden zu haben – und das, obwohl alle Prognosen bereits im Mai darauf hindeuteten, dass sich die Lage im Herbst verschärfen würde. Darin sieht Kittel eine verfehlte Kommunikationsstrategie: „In den engen Beratungskreisen der Regierung war damals bereits bekannt, dass wir noch viele Monate in dieser Pandemie sein werden. Die Kommunikationsstrategie ‚Wir haben es überstanden‘ hat den falschen Drall gegeben und schließlich dazu beigetragen, dass die Infektionszahlen im September gestiegen und im Oktober explodiert sind“, beschreibt Kittel die Dynamik.
„Wenn weniger als die Hälfte der Bevölkerung mit der Regierungsarbeit zufrieden ist, ist das ein Alarmzeichen.“
Jeder Dritte ist unzufrieden
Was aus den Daten des Austrian Corona Panels klar hervorgeht: Die Zustimmung zu den Corona-Maßnahmen hängt stark davon ab, wie sehr man den politischen Institutionen vertraut. Je höher das Vertrauen in die Regierung, desto mehr ist jemand bereit, sich an die Verordnungen zu halten. Und hier liegt einer der Gründe, warum sich Lockdown zwei völlig anders anfühlt als Lockdown eins. Die gesundheitliche und die wirtschaftliche Gefahr werden zwar gleich hoch eingeschätzt wie am Anfang der Pandemie. Aber Ende März gab es nur zehn Prozent Unzufriedene, jetzt liegt der Wert bei 33 Prozent. Nur die Hälfte der Befragten ist zufrieden mit der Regierungsarbeit, wobei der überwiegende Anteil „eher zufrieden“ ist und nicht „sehr zufrieden“. Sehr zufrieden sind gerade einmal 10 Prozent. „Wenn weniger als die Hälfte der Bevölkerung mit der Regierungsarbeit zufrieden ist, ist das ein Alarmzeichen“, warnt Kittel und er verdeutlicht: „Das ist eine Verdreifachung innerhalb eines halben Jahres.“
Solidarität sinkt und Kurzarbeit hilft
Eine andere Entwicklung, die der Sozialwissenschaftler anhand seiner Daten ebenfalls deutlich sehen kann, ist die Abnahme der Solidarität. Wenn noch im März 62 Prozent der Befragten angaben, sie seien der Ansicht, der Zusammenhalt in der Gesellschaft habe sich mit der Krise erhöht, so ist dieser Wert von Erhebungswelle zu Erhebungswelle stetig gesunken und liegt aktuell bei 14 Prozent. Besonders stark trifft die Krise jene, die es schon vorher schwer hatten: Alleinerziehende, die fast ausschließlich Frauen sind, kleine Selbständige wie freie Dienstnehmer und sozial schwache Schülerinnen und Schüler. Stark betroffen sind auch all jene, die in der Krise ihre Arbeit verloren haben.
„Die Kurzarbeit hat viele Menschen vor psychischen Problemen gerettet.“
Was die psychische Belastung der Arbeitslosen anbelangt, sieht man anhand der Daten deutlich, dass die Neigung zu Depressionen mit dem Jobverlust sprunghaft angestiegen ist. Dieser Zusammenhang zwischen Arbeit und Depressionsneigung wird allerdings auch umgekehrt deutlich: Jenen, die während der Krise einen Job bekommen haben – vor allem in den seit dem Lockdown boomenden Branchen wie der Paketzustellung –, ging es psychisch sprunghaft besser. Die Menschen, die im ersten Lockdown in Kurzarbeit waren – immerhin jeder vierte Beschäftigte –, blieben vergleichsweise psychisch stabil. „Die Kurzarbeit hat viele Menschen vor psychischen Problemen gerettet“, sagt der Wissenschaftler.
Die Krise verdeutlicht die Schulmisere
Die Pandemie hat laut Kittel eine Entwicklung verschärft und beschleunigt, die er bereits seit Jahren beobachtet, nämlich die Zunahme der Spaltung der Gesellschaft nach Bildung und Arbeitsmarktchancen: „Sie verdeutlicht die Misere, die in unseren Schulen seit Jahrzehnten offenkundig ist, herbeigeführt durch die gegenseitige Blockade der großen politischen Lager in der Zweiten Republik.“ Und er nennt ein Beispiel: „In Wiener Volksschulen ist die Differenz zwischen den besten und den schlechtesten Schülerinnen und Schülern mehrere Jahre Lernleistung. Da läuft etwas ganz Grundlegendes falsch. Das verhindert Entwicklungschancen und führt zu einem Auseinanderdriften der Gesellschaft.“
Es bräuchte eine massive Förderung
Was es bräuchte, sei eine massive Förderung der sozial schwachen Schülerinnen und Schüler, die bereits vor der Krise vernachlässigt worden sind. Gefragt seien hier Bildungs- und Sozialpolitik. Angesichts des rigorosen Sparkurses, der die österreichische Bevölkerung erwarten wird, fürchtet Kittel jedoch, dass diese Probleme nicht Priorität haben werden. „Was es bedeutet, dass hier eine Generation heranwächst, in der die Chancen noch stärker auseinanderdriften, wo viele abgehängt werden, diese Probleme wird man erst in den nächsten Monaten und Jahren richtig sehen.“
„In Wiener Volksschulen ist die Differenz zwischen den besten und den schlechtesten Schülern mehrere Jahre Lernleistung.“
Verlust des Gemeinsamen in Rekordtempo
Eine Entwicklung, die der Sozialwissenschaftler ebenfalls mit Sorge beobachtet, ist die Zunahme der Skepsis gegenüber der Demokratie. Auch hier habe sich durch die Corona-Pandemie eine Entwicklung beschleunigt: „Von März bis November sehen wir hier Veränderungen in einem Ausmaß, wie man sie sonst vielleicht in einem Zeitraum von fünf bis zehn Jahren beobachten kann.“ Bereits in den vergangenen 30 Jahren sei mit der Liberalisierung der Finanzmärkte eine Spreizung der Einkommen und Vermögen zu beobachten, damit einhergehend eine Abkopplung von Gruppen an der gesellschaftlichen Teilhabe und eine Radikalisierung nicht unbeträchtlicher Teile der Bevölkerung. „Das führt zusehends in eine Situation, die das Gemeinsame – die gesellschaftliche Solidarität und Integration – verliert“, warnt Kittel.

Nur jeder Dritte will sich impfen lassen
Seit Beginn der Corona-Pandemie forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit unter Hochdruck an einem Impfstoff, der uns eine Rückkehr zum alten Leben ermöglichen soll. Es ist Licht am Horizont und Ende 2020 soll in Österreich mit der ersten Impfphase begonnen werden. Doch Kittels Zahlen sprechen hier eine deutliche Sprache: Die Impfbereitschaft hat von Mai bis Oktober 2020 stark abgenommen: Wollten sich im Mai 2020 noch etwa die Hälfte der Bevölkerung ehestmöglich impfen lassen, so ist dieser Anteil bis Oktober 2020 auf ein Drittel gesunken. Unter den Impfgegnern hat sich die Skepsis noch verfestigt. Wobei die Impfbereitschaft nicht nur mit der Wahrnehmung der persönlichen Gefährdung, dem Alter und dem Geschlecht zusammenhängt, sondern auch mit der Zufriedenheit mit der Regierungspolitik.
Es sind eher Ältere, Männer, höher Gebildete und politisch eher links Positionierte, die bereit sind, sich impfen zu lassen. Frauen, die durch die Mehrbelastung in der Krise durch Pflege, Familienarbeit und Homeschooling wesentlich stärker getroffen sind, sind insgesamt unzufriedener und tendenziell weniger bereit, sich impfen zu lassen. Auch Menschen mit Lehrabschluss – stärker von Arbeitslosigkeit betroffen – sind unzufriedener und lehnen eine Impfung eher ab. Die größten Impfgegnerinnen und Impfgegner aber findet man unter den erklärten Nichtwählerinnen und Nichtwählern. „Das sind Leute, die sehen sich nicht mehr als Teil der Gesellschaft“, verdeutlicht Kittel.
Facebook statt seriöser Medien
Die Bereitschaft, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, hängt auch davon ab, wo und wie man sich informiert und welche Medien man für relevant erachtet. Die Studienergebnisse dazu nennt Kittel „schockierend“: „Es gibt eine knallharte Differenzierung nach Bildungsstand, ob jemand seriöse Medien zu Rate zieht oder nur Facebook-Einträge und Instagram-Posts.“ Dass die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie die Bevölkerung spalten und gleichzeitig die Bereitschaft zu einer Impfung, mit der man sich selbst schützt und die zur Überwindung der Krise beiträgt, abnimmt, ist paradox und eine beunruhigende Fehlentwicklung. Was also tun?
„Es braucht eine breite gesellschaftliche Diskussion über die Impfung.“
Gesellschaftliche Diskussion statt Message-Control
„Es braucht eine breite gesellschaftliche Diskussion“, sagt Kittel. Viele Menschen seien verunsichert, weil man noch wenig über die in Rekordtempo erzeugten Impfstoffe weiß. In sozialen Netzwerken kursieren Gerüchte wie jenes, die neuartige RNA-Impfung verursache Krebs. Darüber müsse man diskutieren. Kittel ortet hier ein Versäumnis in der Kommunikation der Regierung: „Der Diskurs hat sich in die sozialen Medien verlegt, wo Verschwörungstheorien, unfundierte Meinungen und ‚alternative Fakten‘ denselben Stellenwert bekommen wie wissenschaftlich geprüfte Aussagen. Das sind die desaströsen Folgen einer Kommunikation, die auf Message-Control setzt, statt eine gesellschaftliche Diskussion anzuregen und sich dieser auf Augenhöhe zu stellen.“

Den gesellschaftlichen Konsens finden
Eine mögliche Strategie wäre, eine sogenannte „Deliberative Poll“ durchzuführen. Das ist eine Methode, die besonders bei gesellschaftlich hoch kontroversiellen Themen zu nachhaltigen Lösungen führen kann, da diese von einem Großteil der Bevölkerung getragen werden. Basis ist ein Pool aus einer repräsentativen Stichprobe der Bevölkerung, die gemeinsam mit verschiedenen Expertinnen und Experten diskutieren. Aus der Vielzahl divergierender Meinungen werden in einem diskursiven Prozess, der transparent ist und medial unterstützt wird, Antworten auf die Frage erarbeitet, wie man als Gesellschaft mit der Krise umgehen soll. Der Vorteil: Jeder sieht sich mit seinen Interessen in diesem Stichproben-Pool vertreten und damit hat die Lösung eine breite Basis in der Bevölkerung. Der berühmteste Fall, wo diese Methode zu einem gesellschaftlichen Konsens geführt hat, war die Frage der Abtreibung in Irland, ein hoch kontroversielles Thema in diesem streng katholischen Land. Im Anschluss zu diesem Prozess stimmte das irische Volk am 25. Mai 2018 für die Aufhebung des Abtreibungsverbotes. „Auch wenn es noch ein paar Gegnerinnen und Gegner gibt, aber die Gesellschaft hat sich in diesem Prozess geeinigt“, berichtet Kittel von diesem demokratiepolitischen Erfolg.
„Es ist nie zu spät zu diskutieren“
Der Sozialwissenschaftler ist überzeugt, hätte man diesen Prozess in Österreich in den Sommermonaten durchgeführt, wäre es möglich gewesen, bis September einen gesellschaftlichen Konsens über viele Fragen zu finden. Warum dieser Weg nicht eingeschlagen wurde? „Diesen Prozess hätte man finanzieren und die Kontrolle abgeben müssen. Das entspricht nicht der Strategie unserer Regierung“, stellt Kittel fest. Was aber muss die Politik tun, um das Vertrauen der Bevölkerung wieder zu gewinnen? „Es ist nie zu spät zu diskutieren“, postuliert Bernhard Kittel. „In dieser Situation müssten alle die parteipolitische Brille ablegen, ihre Konkurrenzkämpfe niederlegen und sich auf Lösungen konzentrieren.“
Hoffnung für die Umwelt?
Mit der bevorstehenden Zulassung mehrerer Impfstoffe gibt es Hoffnung auf ein Ende der Pandemie – sofern sich ausreichend Menschen impfen lassen. Und wie steht es um die Hoffnung auf ein Umdenken für den Klimaschutz? In Brasilien wird im Schatten der Pandemie der Regenwald in einem Tempo abgeholzt wie seit zwölf Jahren nicht mehr. Pro Minute verschwinden drei Fußballfelder Urwald. Satellitenbilder der brasilianischen Weltraumbehörde INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) zeigen eine Zunahme der Rodungen im Juni 2020 um knappe 11 Prozent zum Vergleichszeitraum 2019. Zwischen August 2019 und Juli 2020 haben Rodungsfirmen insgesamt 11.000 Quadratkilometer Wald zerstört. Diese Zahlen sprechen für sich. Aber auch Tatsachen wie jene, dass im Oktober die Heizschwammerl in den heimischen Gastgärten aus dem Boden geschossen sind – ein Trend, der durch das Gebot des Abstandhaltens noch befeuert wird. Für konsequente Nachhaltigkeit braucht es wohl doch mehr als ein Virus.
Zur Person
Der Politikwissenschaftler und Soziologe Bernhard Kittel erhielt im August 2020 als einer der Ersten eine Akutförderung des FWF, womit die Finanzierung seines Austrian Corona Panel weiter gesichert war. Mit der Arbeit an dieser größten sozialwissenschaftlichen Corona-Studie in Österreich begann er bereits Ende März. Seitdem werden monatlich 1.500 Menschen – eine für das Land repräsentative Stichprobe – befragt und liefern Daten zu wichtigen Fragen über den Umgang mit der Krise.
Der 53-jährige in der Schweiz und den Niederlanden aufgewachsene Wiener studierte Politikwissenschaften an der Universität Wien und erhielt nach der Promotion einen Master in Social Science Data Analysis der University of Essex, Großbritannien. Er forschte am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln, war Juniorprofessor für Sozialpolitik an der Universität Bremen, Professor für Soziologie an der Universität Amsterdam und Professor für Methoden der empirischen Sozialforschung an der Universität Oldenburg, wo er von 2008 bis 2010 Gründungsdekan der Fakultät für Bildungs- und Sozialwissenschaften war. Seit März 2012 ist Bernhard Kittel Professor am Institut für Wirtschaftssoziologie der Universität Wien.





