Wie die Musik ins Drehbuch kommt
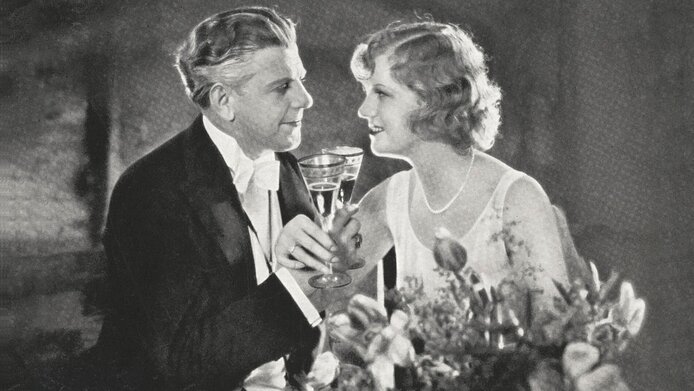
Die ersten Minuten des Operettenfilms „Zwei Herzen im 3/4 Takt“ aus dem Jahr 1930 erscheinen wie eine musikalische Welle, die in der Wiener Kompositionsstube Franz Schuberts beginnt, zunehmend anschwillt und langsam die ganze Stadt erfasst: Zum Walzer, den Schubert am Klavier spielt, tanzen die Schmetterlinge am Fenster, unterhalb desselben pfeift ein Bursche dazu, ein Gitarrenspieler am Fenster gegenüber stimmt ein. Dann kommt die Geige eines Straßenmusikanten dazu, und auch einige Militärmusiker, die am Straßenrand zusammensitzen, beteiligen sich. Wäscherinnen beginnen zu tanzen. Schließlich wird in eine Heurigenszene überblendet, in der Schrammelmusiker dieselbe Walzermelodie spielen.
Für den Filmwissenschaftler Claus Tieber, der an der Universität Wien im Bereich Musik und Film forscht, sind Szenen wie diese besonders interessant. Im Projekt „Drehbuch schreiben und musikalische Nummern“, das vom Wissenschaftsfonds FWF unterstützt wurde, untersuchte er, in welcher Weise Musiknummern dieser Art im Drehbuch vorweggenommen werden. „Musik ist heute kaum ein Teil von Drehbüchern. Darin sind meist nur visuelle Szenenbeschreibungen und Dialoge enthalten. Gegebenenfalls gibt es Aussparungen für Musiknummern“, beschreibt Tieber. „Im frühen Tonfilm gab es allerdings noch keine vorgeprägten Lösungen, wie Musik von den Autoren in ihre Drehbücher eingebaut wird. Sie hatten zum Teil noch einen viel größeren Einfluss auf die Gestaltung von Musiknummern.“
Einer der Drehbuchschreiber, mit denen sich Tieber im Projekt befasst hat, ist Walter Reisch. Der 1903 geborene Wiener war eine zentrale Figur des frühen Wiener Tonfilms und musste als Jude Mitte der 1930er-Jahre vor den Nazis in die USA flüchten. „Reisch hat gemeinsam mit dem Schauspieler und Regisseur Willi Forst den Wiener Film der damaligen Zeit geprägt, der Wien als Musikstadt inszenierte. Seine Arbeit wurde zum prägenden Einfluss für den späteren österreichischen Unterhaltungsfilm der 1950er-Jahre und damit für Streifen von ‚Hallo Dienstmann‘ bis ‚Sissi‘“, ordnet Tieber ein. „Reisch konnte nach der Flucht seine Karriere in Hollywood fortsetzen. Auch hier wurde er für Filme berühmt, in denen musikalische Nummern zentral sind.“
Wenn Schubert in Schwung kommt
In „Zwei Herzen im 3/4 Takt“ des Regisseurs Géza von Bolváry stammt die Musik von Robert Stolz. Der Film ist auch deshalb besonders, weil er die Grundlage einer wenige Jahre später uraufgeführten Bühnenfassung mit unveränderter Musik war. Reischs Filmdrehbuch diente auch hier als Grundlage. Die beschriebene Eingangsszene der Filmfassung spiegelt sich im Drehbuch mit einer – für heutige Verhältnisse – sehr genauen Darstellung der musikalischen Entwicklung: „Schubert spielt weltentrückt, geistesabwesend, nur der Musik hingegeben – immer flotter, immer jubelnder, immer mehr in Schwung kommend“, ist hier zu lesen. „Bei der neuerlichen Wiederholung des Walzermotives setzt das improvisierte Straßenorchester voll ein – Spinett, Laute, Trommel, Geige, Gesang, Pfeifen.“ Sogar eine Instrumentierung wird also aufgezählt.
Die europäischen Unterhaltungsfilme der 1930er-Jahre hatten einen prägenden Einfluss auf die erfolgreichen Filmmusicals aus Hollywood. Drehbuchautor:innen bauten Musiknummern detaillreich in ihre Handlungen ein.

Noch weiter geht Reisch in dem Film „Silhouetten“ aus dem Jahr 1936, der eine seiner letzten Produktionen in Österreich war. Die Geschichte um ein Ballettensemble mündet in einer 15-minütigen Tanznummer, in der etwa der Donauwalzer oder die Wiener Karlskirche auftauchen. „Für die Silhouette-Schlussnummer hat Reisch eine detaillierte Beschreibung, die den Rahmen des Drehbuchs sprengen würde, einfach in einen vierseitigen Anhang ausgelagert. Das ist eine Vorgangsweise, die man in Hollywood-Drehbüchern jener Zeit nicht finden würde“, betont Tieber. „Reisch war selbst kein Musiker. Es ist aber faszinierend, wie exakt seine musikalischen Vorgaben sind.“
Musik als strukturierendes Element
Das Studium seiner Drehbücher macht schnell klar, wie sehr Reisch die Musik bereits im Drehbuch mitdachte. „Der musikalische Teil wird nicht im Nachhinein auf eine Szene ,draufgesetzt‘, sondern ist ein zentrales und strukturierendes Element der Planung und ein integrativer Teil der Filmerzählung“, resümiert Tieber. An vielen der damaligen Drehbücher kann man die Bedeutung der Musik bereits an formalen Gegebenheiten und am Schriftbild erkennen.
„Oft wurde ein zweispaltiges Format genutzt: Auf der einen Seite wird beschrieben, was zu sehen, auf der anderen, was zu hören ist“, schildert der Filmwissenschaftler. „Nicht immer wird den Vorgaben genau gefolgt, dem musikalischen Anteil wird aber von vornherein viel Raum gegeben.“ Gleichzeitig bestimmt in vielen der „musikalischen Momente“ die Musik, was im Film genau zu sehen ist – etwa indem durch Bildschnitt, Kamerapositionen oder eine Rhythmisierung der Geräusche von Alltagsgegenständen die Musik richtiggehend visualisiert wird.
Für Tieber ist die Arbeit Reischs ein Bindeglied, das die Wiener Operettentradition mit den Musikfilmen Hollywoods verbindet. „Gemeinsam mit Kollegen wie dem Berliner Drehbuchautor Felix Jackson, der ebenfalls zur Flucht gezwungen wurde, repräsentiert Reich einen europäischen Einfluss auf die enorm erfolgreichen Filmmusicals aus Hollywood“, beschreibt der Filmwissenschaftler. Heute sind Drehbücher eine Textform, die besonders stark normiert ist.
Das liegt nicht zuletzt an der Digitalisierung – an Computerprogrammen, die den Schreibenden eine konkrete formale Vorgangsweise abverlangen. Aus Tiebers Sicht ist bemerkenswert, dass die Gestaltung von Musiknummern bei dieser Normierung weiterhin außen vor bleibt. „Musikfilme sind auch heute noch erfolgreich, wie etwa das Beispiel des Musicals ,La La Land‘ aus dem Jahr 2016 zeigt. Dass sich nach wie vor keine einschlägigen Drehbuchregeln dafür etabliert haben, ist erstaunlich“, sagt der Filmwissenschaftler. „Dabei ist gerade dieser nicht erzählende Teil, zu dem die Musik gehört, wesentlich dafür verantwortlich, dass sich Menschen einen bereits bekannten Film immer wieder ansehen wollen.“
Zur Person
Claus Tieber ist Privatdozent am Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft der Universität Wien und forscht zur Theorie des Drehbuchschreibens, zu Erzählweisen in Hollywood-Filmen und zum Themenbereich Musik und Film. Das von 2018 bis 2023 laufende Projekt „Drehbuch schreiben und musikalische Nummern“ wurde vom Wissenschaftsfonds FWF mit 358.000 Euro gefördert. Im März 2024 wurde das Nachfolgeprojekt „Der Einfluss des Tonfilms auf das Drehbuch 1927–1934“ vom FWF bewilligt.
Publikationen
Tieber, Claus: Narrating with Music: Screenwriting Musical Numbers, in: Davies, Rosamund; Russo, Paolo und Tieber, Claus (Hg.), The Palgrave Handbook of Screenwriting Studies. Cham: Palgrave Macmillan 2023
Tieber, Claus: Musik im Film, Musik für den Film: Analysefelder und Methoden, in: Hagener, M., Pantenburg, V. (Hg.) Handbuch Filmanalyse, Springer VS, Wiesbaden 2020
Tieber Claus, Wintersteller Christina: Writing with Music: Self-Reflexivity in the Screenplays of Walter Reisch, in: Arts 9 (1), 13, 2020





