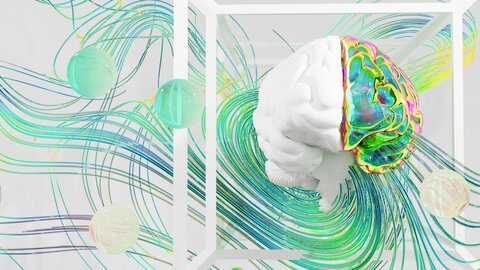Wenn die Gletscher dunkel werden

An wenigen Orten manifestieren sich die Folgen der menschengemachten Klimakrise plakativer als auf den Gletschern in den Ostalpen. Laut Prognosen sind einige kleine Gletscher bereits in wenigen Jahren verloren. Selbst dann, wenn die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius begrenzt wird, werden am Ende dieses Jahrhunderts nur mehr Reste der Weißen Riesen übrig sein. Die Zukunft der heimischen Gletscher sieht also düster aus. Doch wie genau sagt man sie voraus?
Die Sonnenstrahlung, die auf die Oberfläche des Gletschers trifft, liefert Energie für die Eisschmelze. „Um genauer zu verstehen, wie sich die Gletscher entwickeln werden, ist es wichtig, die Albedo besser zu verstehen“, sagt Lea Hartl vom Institut für Interdisziplinäre Gebirgsforschung (IGF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Die Albedo ist ein Fachbegriff für eine Messgröße, die bezeichnet, wie viel Sonnenstrahlung von der Gletscheroberfläche reflektiert wird.
Die Gletscher liegen blank
„Wenn ein Gletscher schneebedeckt, also weiß ist, reflektiert seine Oberfläche Sonnenenergie. Je dunkler er ist, desto größer ist der Anteil des Lichts, der absorbiert wird und so direkt die Gletscherschmelze vorantreibt“, erklärt die Glaziologin. Das Problem? Wenn die schützende Schneedecke fehlt, schreitet die Schmelze schneller voran. „Die Gletscher in Österreich und in den Ostalpen sind im Sommer mittlerweile mehrheitlich blank“, berichtet Lea Hartl. Sie erforscht im Projekt „Gletscher-Albedo: In-situ-Prozesse und Fernerkundung“, wie sich die Reflexionsfähigkeit und damit die Zukunft der Gletscher besser darstellen und vorhersagen lässt.
Wie dunkel das Gletschereis ist und demnach, wie stark es schmilzt, wird von mehreren Faktoren beeinflusst, die zeitgleich auftreten können. Flüssiges Wasser, das sich etwa in starken Schmelzjahren auf der Gletscheroberfläche sammelt, verdunkelt Teile der Gletscheroberfläche und treibt den Schmelzvorgang voran. Auch Teilchen, die sich auf Schnee, Firn oder Eis des Gletschers ablagern, verdunkeln die Oberfläche. Partikel, die Gletscher verdunkeln, können organisch sein, wie Pollen und Algen, oder anorganisch, wie Gesteinsstaub. Manche, wie Staubpartikel aus der Sahara, werden von weit her angeweht. Andere kommen aus der nahen Umgebung oder leben, wie die Eisalgen, sogar dort. Diese kleinen Mikroorganismen bilden ein braunes Pigment, das die Gletscheroberfläche aus der Ferne rosarot erscheinen lässt.
Das Projekt
Um die Zukunft der Gletscher besser vorhersagen zu können, braucht es Wissen über die unterschiedlichen Faktoren, die die Schmelze vorantreiben. Ein Team um Lea Hartl kombiniert Messdaten von Gletscheroberflächen mit Daten von Satellitenbildern, was mehr Wissen über das Verschwinden der Weißen Riesen liefern soll.
Vom Kleinen zum Großen – und zurück
Der Gepatschferner im Tiroler Kaunertal ist Lea Hartl gut vertraut. Dort hat sie schon zahlreiche Feldforschungen durchgeführt. Mit dem vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projekt will sie nun herausfinden, was konkret das Eis verdunkelt. In einer von der ÖAW betriebenen Langzeit-Messstelle samt Wetterstation werden am Gepatschferner Datenreihen erhoben. Diese Daten zeigen der Glaziologin, wie sich die Reflexionsfähigkeit der Eisoberfläche verändert. In Zusammenarbeit mit Kolleg:innen will Lea Hartl herausfinden, welchen Anteil diese Änderung an der Gletscherschmelze hat. „Ein weiteres Ziel des Projektes ist, herauszufinden, wie man lokal erhobenes Wissen in vorhandene Gletschermodelle einfließen lassen und eine bessere Verbindung zwischen örtlichen Messungen und globalen Modellen schaffen kann“, erklärt sie.
Bilder aus dem All
Zusätzlich zu den Daten aus dem Kaunertal greift die Forscherin auch auf offen verfügbare Geo-Satellitendaten zurück. Etwa auf sogenannte Echtfarbenbilder, die die Erdbeobachtungssatelliten Sentinel-2A und Sentinel-2B des EU-Raumfahrtprogramms Copernicus liefern. „Auf diesen Bildern kann man sehen, wie die reflektierte Strahlung über dunklen Stellen in einem bestimmten Wellenlängenbereich absinkt. Das bedeutet, dass die Strahlung dort absorbiert wird“, erklärt Lea Hartl. Aus den Satellitendaten lässt sich die Albedo der Gletscherfläche ableiten.
Allerdings ist die räumliche Auflösung der Satellitendaten zu grob, um sehr kleinskalige Prozesse zu erfassen. Zudem überfliegen die Satelliten nur etwa einmal die Woche spezifische Stellen wie den Gepatschferner. Zudem können Wolken die Sicht auf den Gletscher einschränken. Doch die Reflexionsfähigkeit der Gletscheroberfläche kann sich von Tag zu Tag und auch im Tagesverlauf ändern, etwa wenn sich an warmen, sonnigen Tagen oberflächliches Schmelzwasser bildet. Lea Hartl kombiniert deshalb verschieden aufgelöste Daten. Aktuell vergleicht sie die Satellitendaten mit jenen der Wetterstation am Gepatschferner. „Mich interessiert, ob man mit den Daten der Wetterstation den Albedo-Wert der Satellitendaten validieren kann“, erläutert die Glaziologin.

Daten aus dem Flugzeug
Ein Forschungsflugzeug der Universität Zürich, das im Herbst des Jahres 2024 den Gepatschferner überflog, liefert weitere Hinweise. Mit einem darauf installierten bildgebenden Spektrometer machten die Forschenden eine Aufnahme des Gletschers. „In jedem der einzelnen Pixel in diesem Bild ist eine gesamte spektrale Kurve abgebildet – also Werte von 300 bis 400 Farbbändern pro Pixel“, erklärt Lea Hartl. Zum Vergleich: die Sentinel-2-Satelliten liefern 13 Farbbänder.
Die Glaziologin evaluiert, inwiefern sich die Ergebnisse dieser hoch aufgelösten Daten von jenen der Satelliten unterscheiden. „Das ist wichtig zu wissen – denn wenn sich der Mehrwert in Grenzen hält, können wir mit den offen und global verfügbaren Satellitendaten weiterarbeiten. Wenn es Unterschiede gibt, wissen wir, dass wir genauere Daten von der Eisoberfläche brauchen, um bestimmte Prozesse zu erfassen“, erklärt sie.
In den Jahren, in denen Hartl bereits die heimischen Gletscher erforschte, hat sie miterlebt, wie dunkel diese schon geworden sind. Das Jahr 2022 war ein besonders schlechtes Jahr für die Gletscher mit starker Schmelze. Das lag zum einen daran, dass Firn abschmolz und das Eis deshalb frei lag, zum anderen, dass die Oberfläche dunkel war. „Sowohl anhand der Daten der Wetterstation als auch anhand der Satellitendaten haben wir gesehen, dass es in den vergangenen Jahren Phasen gab, in denen das Eis teilweise so dunkel war wie die Steine daneben“, erzählt Lea Hartl.
Puzzeln auf dem Eis
Diesen Sommer, wenn es die Schneelage zulässt, will die Glaziologin nun weitere Daten sammeln. Ein Spektroradiometer (ein Lichtmessgerät) im Rucksack, wird sie auf dem Gepatschferner Punktmessungen durchführen, um die Reflexionseigenschaften der Eisoberfläche detailliert zu erfassen. In Kombination mit Daten aus der Wetterstation lassen sich so Aussagen darüber treffen, wie sich die Verdunkelung der Gletscheroberfläche über den Tag verändert.
„Es macht mir sehr viel Spaß, die verschiedenen Elemente zusammenzusetzen“, erzählt Lea Hartl. „Manchmal hat man ein Bild im Kopf, aber in der Praxis passt es nicht. Dann muss man sich überlegen, wo man falschlag und was uns die Messdaten stattdessen zeigen. Das ist wie ein großes, kompliziertes Puzzle.“ Im Mai 2026 wird das Forschungsprojekt abgeschlossen und das Puzzle zu großen Teilen zusammengesetzt sein. Die erste Publikation aus dem Projekt wird in Kürze erscheinen. Das Wissen, das Lea Hartl durch Daten am Gepatschferner sammelt, kann helfen, zu zeigen, wie düster die Gletscher und damit ihre Zukunft noch werden.
Zur Person
Lea Hartl hat Meteorologie, Geophysik und physische Geografie an der Universität Innsbruck studiert und dort zu Blockgletschern im Klimawandel promoviert. Die Glaziologin forscht als Senior Postdoc am Institut für Interdisziplinäre Gebirgsforschung (IGF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Innsbruck unter anderem zu Eis-Albedo und Blockgletschern und trägt zu Forschungen des Hyperspectral Imaging Laboratory der University of Alaska Fairbanks, USA, bei. Das Projekt „Gletscher-Albedo: In-situ-Prozesse und Fernerkundung“ (2023–2026) wird vom Wissenschaftsfonds FWF im Förderprogramm ESPRIT mit 294.000 Euro gefördert.
Publikationen
Recent observations and glacier modeling point towards near-complete glacier loss in western Austria (Ötztal and Stubai mountain range) if 1.5 °C is not met, The Cryosphere 2025
Loss of accumulation zone exposes dark ice and drives increased ablation at Weißseespitze, Austria, EGUsphere 2025, Preprint