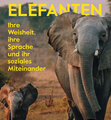Gepardengezwitscher
Tarnen sich Geparden, indem sie Laute von sich geben, die sich von Vogelgezwitscher nicht unterscheiden lassen? Grund dazu hätten sie. Immerhin werden bis zu 70 Prozent ihrer Jungtiere von Hyänen und Löwen getötet.

Die südafrikanische Savanne brütet unter der prallen Sonne. Der Wind streift durch das hohe Gras und zwischen den wenigen Bäumen hindurch, die Schatten spenden. Vögel schwirren umher und zwitschern lauthals. Doch nicht alles ist so, wie es scheint. Zwischen den vertrauten Vogelstimmen versteckt sich ein Ruf, der zu einem ganz anderen, viel größeren Tier gehört – dem Gepard.
So in etwa kann man sich die Szenerie an einem Feldforschungstag von Angela Stöger vorstellen. Sie ist Biologin in leitenden Positionen an der Universität Wien und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und beforscht seit über einem Jahrzehnt, welche Geräusche Säugetiere produzieren und wie diese mit ihrem Verhalten zusammenspielen.
„Ich habe mich immer schon dafür interessiert, wie Säugetiere kommunizieren“, erinnert sich Stöger. Nach einem Studium an der Universität Wien promovierte sie zum Thema der akustischen Kommunikation von Elefanten. Seitdem untersucht Stöger zusammen mit ihrem Team, wie und wieso insbesondere Elefanten Laute produzieren.
„Elefanten können eine Vielzahl von Geräuschen machen“, erklärt die Wissenschaftlerin. „Von einem hohen Quietschen bis zu einem tiefen Grollen, das bis in den Infraschall reicht.“ Infraschall bezeichnet Töne, die so tief sind, dass Menschen sie nicht mehr wahrnehmen können. Doch Elefanten können sie hören und damit über weite Strecken kommunizieren.
Stöger untersucht, wie genau die Elefanten diese Laute erzeugen. „Mit einer akustischen Kamera, die mittels mehrerer Mikrofone die Quelle eines Geräusches finden kann, können wir sehen, wo genau die Laute produziert werden. Damit haben wir zum Beispiel gezeigt, wie die Tiere Luft zwischen ihre Lippen oder durch ihren Rüssel pressen, um bestimmte Laute zu erzeugen.“

Doch die Forschenden gaben sich nicht damit zufrieden herauszufinden, wie die Tiere die Laute erzeugen. Sie wollten auch wissen, wie sie auf ihre eigene „Sprache“ reagieren. Stöger und ihr Team spielten daher Elefanten in der Wildnis ihre Aufnahmen vor. „Wir konnten zeigen, dass Elefanten Laute, die sie hören, nachahmen – also vokal lernen – können.“ Vokales Lernen kennt man von Kleinkindern, die Wörter nachahmen, doch im Tierreich ist es eine Besonderheit. Die Forscher:innen zeigten sogar, dass einzelne Elefantengruppen eigene „Dialekte“ in ihrer Kommunikation haben und sich so mittels Infraschall über weite Distanzen gegenseitig erkennen können.
Ausgestattet mit diesem breiten Schatz an Erkenntnissen und Erfahrungen, widmen sich Stöger und ihr Team nun in ihrem neuen vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Forschungsprojekt einem anderen Säugetier: dem Gepard.
„Ich habe schon vor zwanzig Jahren angefangen, mich mit Geparden zu beschäftigen“, sagt Stöger. „Diese Tiere produzieren viele Laute – unter anderem ein hohes Zwitschern, das genauso wie der Ruf eines Vogels klingt –, um miteinander zu kommunizieren. Ich habe mich schon damals gefragt, wieso sie das machen.“
Dieses Gezwitscher ist der höchste Laut, den Geparde erzeugen können. Eine plausible Erklärung könnte sein, dass sie sich damit tarnen, um in der Geräuschkulisse der Savanne nicht aufzufallen. Geparde sind zwar formidable Jäger, jedoch müssen sie sich vor anderen Raubtieren in Acht nehmen. Bis zu 70 Prozent der Jungtiere werden von Hyänen und Löwen getötet. „Selbst wenn ich diese Rufe meinen Kolleg:innen aus der Verhaltensbiologie vorspiele, können sie diese kaum von Vogelrufen unterscheiden“, fügt Stöger schmunzelnd hinzu.
Tarnen sich Geparden, indem sie Laute von sich geben, die sich von Vogelgezwitscher nicht unterscheiden lassen? Grund dazu hätten sie. Immerhin werden bis zu 70 Prozent ihrer Jungtiere von Hyänen und Löwen getötet.
„Im Frühjahr 2024 werden wir in die Kalahari-Wüste fahren, um zu untersuchen, wie weit diese Rufe in der dortigen Umgebung hörbar sind, und um deren Effekt auf andere Tiere zu testen“, erklärt Stöger. Um die Gepardenlaute genauer zu verstehen, werden die Forschungsteams sie zu verschiedenen Tageszeiten und unter verschiedenen Wetterbedingungen abspielen und messen, in welchen Abständen sie noch hörbar sind. Außerdem wollen sie herausfinden, ob Löwen und Antilopen diese Geräusche erkennen und darauf reagieren. Ihre Erkenntnisse würden nicht nur das Verständnis dieser Großkatzen vertiefen, sondern könnten Nationalparks und Zoos auch bei der Züchtung von Geparden helfen, die als gefährdet gelten. Stöger fügt hinzu: „Ich freue mich schon sehr auf die nächste Feldreise. Tiere in der freien Wildbahn zu sehen, ist immer etwas ganz Besonderes.“
Angela Stöger habilitierte an der Universität Wien zu Verhaltens- und Kognitionsbiologie und ist Leiterin des vom Wissenschaftsfonds FWF unterstützten Mammal Communication Lab, das seit Kurzem am Institut für Schallforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) angesiedelt ist. Sie ist auch Teil des FWF-geförderten Doktoratsprogramms „Communication and Cognition“ der Universität Wien und der Veterinärmedizinischen Universität Wien. 2023 brachte Stöger das Buch „Elefanten – Ihre Weisheit, ihre Sprache und ihr soziales Miteinander“ heraus, das auf der Shortlist für das Wissenschaftsbuch des Jahres 2024 gelistet wurde.