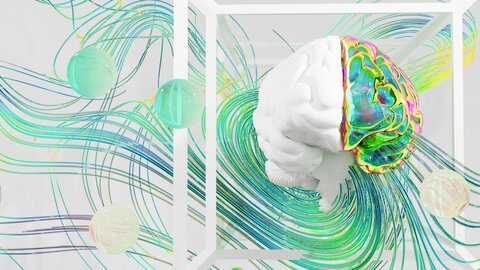Social Media als Trigger für Selbstverletzung
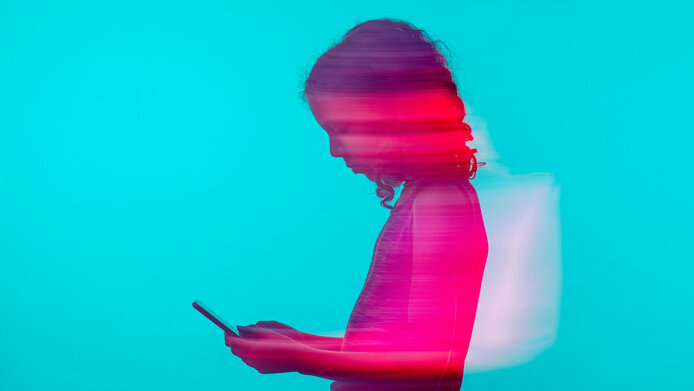
Sich mit einer Rasierklinge ritzen, den Kopf gegen die Wand schlagen oder sich mit Zigaretten selbst brennen. Viele Menschen haben sich auf diese oder ähnliche Weise mindestens einmal im Leben selbst verletzt. „Weltweit betrachtet verletzen sich 15 bis 20 Prozent der Menschen mindestens einmal im Leben selbst. Das ist eine beträchtliche Anzahl“, sagt Oswald Kothgassner, Leiter des Forschungslabors für Stress in der Kindheit und Adoleszenz an der Medizinischen Universität Wien. „Im Alter von 12 bis 18 Jahren häuft sich selbstverletzendes Verhalten – und erreicht im 15. Lebensjahr die höchste Prävalenz“, erklärt der klinische Psychologe, der seit Beginn des Jahres 2022 im Rahmen des Forschungsprojekts „Online-Trigger bei nicht-suizidalen Selbstverletzungen“ deren Auslösern auf den Grund geht.
Ein stiller Schrei nach Hilfe
In erster Linie diene selbstverletzendes Verhalten der Bewältigung einer intensiven inneren Anspannung, erklärt der Forscher. Betroffene empfinden diese als kaum auszuhalten. Viele Jugendliche verfügen noch nicht über entsprechend entwickelte Strategien zur Emotionsregulation. In Momenten überwältigender Gefühle suchen sie nach unmittelbarer Erleichterung. „Indem sie sich selbst Schmerzen zufügen, versuchen sie, inneren Druck abzubauen und ihre Emotionen zu kontrollieren. Neben dieser Funktion kann selbstverletzendes Verhalten aber auch eine Form der Selbstbestrafung oder eine Kommunikationsstrategie nach außen, also ein indirekter Hilferuf an das Umfeld sein“, so Oswald Kothgassner.
Der Forscher und Kolleg:innen interessieren sich dafür, wie Social Media diese selbstverletzenden Verhaltensweisen beeinflussen. Junge Menschen teilen häufig Bilder von Selbstverletzungen auf Plattformen und Messaging-Diensten wie WhatsApp, Snapchat, Tiktok oder Instagram. Im Jahr 2017 wurde ein Fall einer Jugendlichen medial bekannt, die Suizid beging und davor verstärkt auf Social-Media-Plattformen Inhalte zu Selbstverletzung und Suizid konsumiert hatte. „Uns interessierte“, erklärt Oswald Kothgassner, „ob Bilder auf Social Media Selbstverletzungen fördern oder auslösen können.
Das Projekt
Studien der Medizinischen Universität Wien zeigen, dass Jugendliche mit psychischen Belastungen stärker auf negative Bilder in sozialen Medien reagieren. Die dadurch ausgelösten Emotionen erhöhen ihren Druck, sich beispielsweise selbst zu verletzen.
„Im Alter von 12 bis 18 Jahren häuft sich selbstverletzendes Verhalten.“
Vorsichtsmaßnahmen
Nach einer Literaturrecherche erarbeitete er mit Kolleg:innen, darunter der Postdoc Andreas Goreis und Paul Plener, Leiter der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie, im Rahmen des Forschungsprojekts drei Studien. Neben einer Kontrollgruppe nahmen daran auch 50 Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren – vorrangig Patient:innen an der Medizinischen Universität Wien – teil, die sich bereits zuvor selbst verletzt hatten. Der Großteil davon wurde weiblich gelesen, das bedeutet, andere Personen würden sie so beschreiben. Nicht alle würden sich auch selbst so bezeichnen. Es wurde geprüft, ob die jungen Menschen psychisch stabil genug waren, um an der Studie teilzunehmen, zudem wurden sie und ihre Eltern ausführlich über die Studie informiert und ihr Einverständnis wurde eingeholt. Stimmten alle zu, fand ein Gespräch über den Studienaufbau und mögliche Risiken statt. Während der Versuche wandte man strenge Kriterien zum Schutz der Betroffenen an. „Die Proband:innen konnten und können zum Beispiel an jedem Punkt der Studien freiwillig abbrechen und werden dann entsprechend betreut“, erläutert Oswald Kothgassner.
Mit Kunstblut zu neuen Erkenntnissen
Im ersten Schritt wollten die Forschenden herausfinden, ob Bilder selbstverletzendes Verhalten triggern, also auslösen können. Dafür zeigten sie den Proband:innen – 25, die sich bereits selbst verletzt hatten, und 25, die dies noch nie gemacht hatten – jeweils 200 Millisekunden lang vier Bilder auf einem Bildschirm. Je drei davon zeigten neutrale Motive, eines zeigte Selbstverletzungen. Die Jugendlichen sahen dabei keine echten, sondern Fotos von Wunden, die eine Make-up-Artistin den Forschenden unter anderem auf Unterarme und Unterschenkel geschminkt hatte.
„Stimuli im Labor mit Kunstblut und künstlichen Wunden an uns selbst zu entwickeln, war für uns als Forschungsteam eine spannende Erfahrung“, erinnert sich Oswald Kothgassner zurück. Denn dabei müsse man sich auch intensiver mit der Online-Lebenswelt von Jugendlichen auseinandersetzen.
Auch die Ergebnisse dieser Studie, erzählt er, waren spannend. Jugendliche, die bereits eine Vorgeschichte mit selbstverletzendem Verhalten hatten, fixierten das Bild der Selbstverletzungen schnell und lange, nicht betroffene reagierten verhältnismäßig ausgeglichen. „Das deutet auf eine Aufmerksamkeitsverzerrung hin und ist ein Hinweis darauf, dass das Problem eine starke kognitive Komponente hat“, erklärt der Forscher.
Der Druck steigt
Bei der zweiten Studie kam eine App zum Einsatz, die auf den Smartphones der Jugendlichen installiert wurde. Diese fragte eine Woche lang mehrmals täglich unter anderem ab, was die Proband:innen erlebten, ob und wie sie Social Media nutzten, ob sie den Drang verspürten, sich zu verletzen, oder das bereits getan hatten. Die App bat auch Hilfe an, indem sie unter anderem Notrufnummern anzeigte. Auch sie brachte klare Ergebnisse. „Wir sahen bei der Datenauswertung, dass negative Ereignisse auf Social Media, etwa Online-Mobbing, den Druck der Jugendlichen, sich selbst zu verletzen, steigerten“, erklärt Oswald Kothgassner.
„Die Proband:innen waren nach diesen Ereignissen angespannter als nach negativen Ereignissen im echten Leben.“ Selbstverletzungen passierten zwar nach Online-Ereignissen nicht, allerdings nach realen negativen Ereignissen. Wahrscheinlich sei, so Kothgassner, dass negative Erfahrungen auf Social Media Selbstverletzungen nach realen Erlebnissen wahrscheinlicher machen, da sie das Anspannungsniveau erhöhen. Das ist allerdings noch nicht erwiesen.
Die Schmerzen der Ausgrenzung
Die dritte Studie läuft aktuell. Darin wollen die Forschenden herausfinden, welche Situationen – online oder analog – selbstverletzendes Verhalten auslösen. Sie beginnt mit einem sogenannten Täuschungsexperiment, mit dem eine soziale Ausschluss-Situation simuliert wird. Dabei sitzen die Proband:innen jeweils in einem Raum mit zwei weiteren Personen. Sie haben die Aufgabe, einen Ball hin und her zu werfen. Fünf Minuten lang werden die Jugendlichen ausgeschlossen, erhalten den Ball nicht. Im nächsten Schritt sehen sie erneut sehr kurze Zeit vier Bilder, eines davon von Selbstverletzungen. „Wir wollen sehen, wie eine Gruppe, die direkt vorher sozial ausgeschlossen wurde, auf den Kontakt mit Bildern von Selbstverletzungen reagiert“, erläutert Oswald Kothgassner. Danach werden die Proband:innen über das Experiment aufgeklärt.
Bei einem weiteren Versuch interagierten die Teilnehmenden mit einem Computer, der eine mit Instagram vergleichbare Social-Media-Plattform imitiert. Sie zeigte Posts, einschließlich nachgestellter Selbstverletzungen, mit variierender Anzahl an Likes und Kommentaren. Während die Jugendlichen verschiedene Profile durchsehen konnten, erfassten die Forschenden Augenbewegungen, Herzfrequenz und Hautleitfähigkeit. Die Proband:innen wurden zudem mehrfach über den Verlauf der Messung gefragt, ob und wie stark der Drang, sich selbst zu verletzen, war. In der ersten Studie zeigten ihre Herzfrequenz und Hautleitwerte keine Trigger an. Deshalb wollen die Forschenden nun andere verstärkende Faktoren in naturalistischeren Reizen feststellen.
Ein Grundstein für weniger Leid
Im Dezember 2025 soll das Forschungsprojekt, das der Wissenschaftsfonds FWF förderte, abgeschlossen sein. Oswald Kothgassner betont, dass die Ergebnisse noch nicht repliziert wurden. Die Erkenntnisse sind jedoch per se bereits aufschlussreich. Das Projekt beantwortete einige Fragen, zeigte etwa, dass Bilder auf Social Media den Druck, sich selbst zu verletzen, steigern, es warf aber auch weitere Fragen auf.
In einer möglichen Folgestudie möchten die Forschenden besser verstehen, welche Faktoren selbstverletzendes Verhalten im Alltag konkret auslösen können. Mit diesem Wissen ließe sich die Therapie gezielt anpassen. Betroffene könnten so lernen, bestimmte Situationen zu vermeiden oder besser mit ihnen umzugehen. So bliebe vielen, vor allem jungen Menschen, eine Menge an Leid erspart. „Das“, sagt Oswald Kothgassner, „ist unser Ziel und unsere Hoffnung.“
Zur Person
Oswald D. Kothgassner ist klinischer Psychologe und Leiter der Stress in Childhood & Adolescence Research Unit (SCAR) an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Medizinischen Universität Wien. Für seine wissenschaftlichen Arbeiten erhielt er mehrere Auszeichnungen, darunter 2021 den Forschungspreis der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das klinische Forschungsprojekt „Online-Trigger bei nicht-suizidalen Selbstverletzungen“ (2022–2025) wird vom Wissenschaftsfonds FWF mit 378.000 Euro gefördert.
Publikationen
Goreis A., Chang D., Klinger D., Zesch H.E. et al.: Impact of social media on triggering nonsuicidal self-injury in adolescents: a comparative ambulatory assessment study, in: Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation, Springer 2025
Goreis A., Pfeffer B., Gross C.H., Klinger D. et al.: Attentional biases and nonsuicidal self-injury urges in adolescents, in: JAMA network open 2024
Goreis A., Prillinger K., Bedus C., Lipp R. et al.: Physiological stress reactivity and self-harm: A meta-analysis, in: Psychoneuroendocrinology 2023
Hilfe und Beratung
Für Jugendliche in Krisensituationen und deren Angehörige gibt es eine Reihe von Anlaufstellen. Unter suizid-praevention.gv.at finden sich Notrufnummern und Erste Hilfe bei Suizidgedanken. Gesprächs- und Verhaltenstipps, insbesondere für Kinder und Jugendliche, bietet bittelebe.at.
Telefonische Hilfe österreichweit:
Telefonseelsorge: 142
0–24 Uhr, kostenlos
Rat auf Draht: 147
0–24 Uhr, für Kinder und Jugendliche kostenlos
Kindernotruf: 0800 567 567
0–24 Uhr, kostenlos
Kriseninterventionszentrum: +43 (0) 1-406 95 95
Mo–Fr 10–17 Uhr