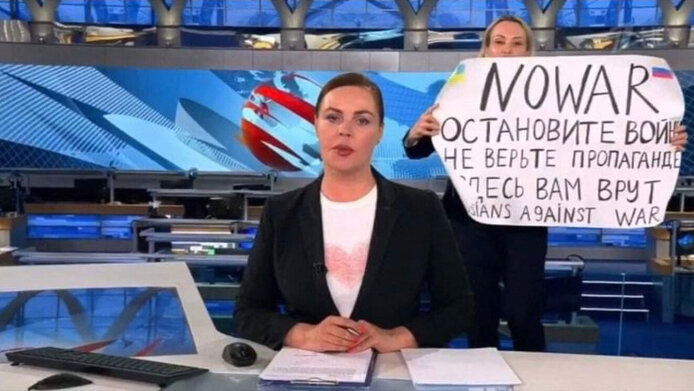Damals habe Russland ganz besonders auf die Reaktion des Westens geachtet. Spürbare Konsequenzen blieben aus. „In den letzten Jahren fühlte sich Putin im Zenit der Macht“, stellt Jobst fest. Es gab „erfolgreiche“ Aktionen in Syrien, der neue US-Präsident Joe Biden wurde als wenig gefährlich eingestuft und die Welt ist seit zwei Jahren mit der Coronapandemie beschäftigt. Lauter Faktoren, die laut Jobst eine Rolle spielen. „Dieses Zeitfenster hat Putin genutzt“, sagt die Historikerin.
Woher der Kampfgeist der Ukraine kommt
Dass der russische Staatschef einige Faktoren falsch eingeschätzt hat, davon ist die Expertin überzeugt. Zum einen habe Putin den Widerstand in der Ukraine unterschätzt. Aber woher kommt deren Kampfgeist? Nomen est omen. Ukraina heißt u. a. „am Rande“. Es ist geografisch und topografisch ein Gebiet, das gut zu durchwandern ist, wo sich immer Menschen getroffen, Handel miteinander getrieben, Kämpfe ausgefochten haben und wieder weitergewandert sind. Weiteres kam hinzu: Seit der frühen Neuzeit bildete sich in der Ukraine ein Protonationalismus aus.
Diese Entwicklung ist universal. „Eine Nation ist nicht einfach da und sie währt auch nicht ewig“, sagt Jobst. Die römischen Kaiser hatten etwa eine andere Vorstellung davon, was Deutsch ist, als wir das heute haben. Auch der Begriff „Österreich“ hat in der Geschichte einen großen Bedeutungswandel erlebt. Wie wir zu solchen auch nationalen Konstrukten stehen, hat sich mit der Zeit gewandelt. Der Prozess der kollektiven Konstruktion von Großgruppenzugehörigkeit ist komplex und wird manchmal durch Katastrophen wie das Eindringen von Feinden befördert. Das ist es, was jetzt gerade in der Ukraine passiert: „Eine größere Stärkung des ukrainischen Nationalbewusstseins als durch diesen Unrechtskrieg Putins hätte es gar nicht geben können“, ist sich die Historikerin sicher.