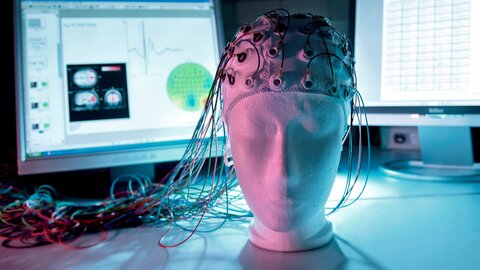Diese Tabakpflanze rettet Leben

Sie hat mittelgroße, hellgrüne Blätter, kam im 15. Jahrhundert nach Europa und ist verwandt mit der Kartoffel und der Tomate. An der Universität für Bodenkultur in Wien hält man das Nachtschattengewächs in einer sogenannten „Klimakammer“ – bei 60 Prozent Luftfeuchtigkeit und konstanten 22 Grad. Das sind die optimalen Bedingungen für Nicotiana benthamiana, eine Tabakpflanze. „Rauchen ist tödlich“ ist auf so mancher Zigarettenpackung zu lesen. In der wissenschaftlichen Verwendung durch Herta Steinkellner verhält es sich jedoch genau umgekehrt: Diese Tabakpflanze kann Leben retten! Sie erzeugt hochwirksame menschliche Antikörper gegen Krankheiten wie Krebs, Ebola und – nun auch – Covid-19.
Genetisch veränderte Tabakpflanze
Dazu wird Nicotiana benthamiana genetisch so verändert, dass sie neben ihren eigenen auch artfremde Proteine herstellt. Zum Beispiel auch Antikörper-Proteine, die normalerweise im menschlichen Körper als Reaktion auf Krankheitserreger produziert werden. Dazu werden jene Gene, die den Bauplan für menschliche Antikörper beinhalten, in die Pflanze eingebracht. „Dafür verwenden wir ein Bakterium als eine Art Taxi. Mit diesem Bauplan setzt die Pflanze dann die speziellen menschlichen Proteine zusammen“, erklärt Herta Steinkellner. Die Pflanze kann so Antikörper-Proteine herstellen, die dann in der Humanmedizin als Medikamente eingesetzt werden können.
Zur Person
Herta Steinkellner ist Professorin am Department für Angewandte Genetik und Zellbiologie der Universität für Bodenkultur (BOKU) Wien. Sie studierte Biologie an der Universität Wien, promovierte und habilitierte danach im Bereich Molekularbiologie und Genetik an der Boku. Von 2010 bis 2017 leitete sie das Laura Bassi Exzellenzzentrum „Plant Produced Proteins“ in Wien. Forschungsaufenthalte und Gastprofessuren führten die Wissenschaftlerin nach Großbritannien, in die USA und nach Japan.
„Der genetische Code ist universell, vom Einzeller bis zu den Säugern.“
Grenzen zwischen Lebewesen verschwimmen
„Möglich ist das, weil sich menschliche und pflanzliche Zellen auf molekularer Ebene sehr ähnlich sind, denn der genetische Code ist universell, vom Einzeller bis zu den Säugern“, erklärt die Professorin vom Department für Angewandte Genetik und Zellbiologie der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien. Auf genetischer Ebene verschwimmen auch die Grenzen zwischen pflanzlichen und tierischen Zellen.

„Wir waren Pioniere“
Normalerweise werden Biopharmazeutika, deren prominenteste Vertreter Antikörper sind, in tierischen Zellen erzeugt. Doch das ist aufwendig und mit hohen Kosten verbunden. Deshalb begann man vor 25 Jahren an der Boku damit, eine alternative Produktionsmethode durch Pflanzen zu erforschen. „Wir waren damals Pioniere“, erinnert sich die Biologin noch heute voll Enthusiasmus an ihre Anfänge. Sie forschte als Doktorandin bei Hermann Katinger, dem damaligen Leiter des Departments für Biotechnologie und Gründer der Firma Polymun. Ihn bezeichnet sie als einen Visionär: „Katinger arbeitete bereits in den 1980er-Jahren zu HIV. Einer der ersten Antikörper, die klinisch getestet wurden, stammte aus seinem Labor“, erzählt die Wissenschaftlerin.
Antikörper gegen Ebola
Als Professorin am Department für Angewandte Genetik und Zellbiologie konzentrierte sich Steinkellner bald auf die Modulation von Proteinen: Verändert man die chemischen Anhänge von Proteinen (z.B. die Zuckerreste), so verändert man ihre Wirkung. „Es stellte sich bald heraus, dass die von uns entwickelten Antikörper gegen HIV wirksamer sind als die aus tierischen Zellkulturen.“ Genauso war es mit den Antikörpern gegen das Ebolavirus. Die hohe Wirksamkeit war schnell erkannt, doch lange Zeit interessierte sich die Welt nicht für Forschung zu Ebola. 2008 begann die Biotechnologin eine Kooperation mit einem US-amerikanischen Biotechunternehmen, das das Ebola-Präparat an Tieren testen ließ.
Ebola-Epidemie 2014
Steinkellner ist gerade auf dem Rückflug von einem Forschungsaufenthalt in den USA, als ihr amerikanischer Kooperationspartner grünes Licht bekommt, das Ebola-Präparat, für das sie die Produktionstechnik entwickelt hat, nun auch an Menschen zu testen. Erste klinische Studien sollen beginnen. „Als ich wenige Stunden später in Wien aus dem Flugzeug stieg, hätten bereits Tausende Infizierte das Mittel benötigt“, erinnert sie sich. Das war im Sommer 2014. Die Ebola-Epidemie, die Anfang des Jahres in Westafrika ausgebrochen war, hatte die westlichen Nachrichten erreicht. Am 8. August 2014 deklarierte die Weltgesundheitsorganisation die Epidemie als „gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite“. Dieses Virus war verheerend, jede:r zweite Infizierte starb daran.
Erster Einsatz der Antikörper beim Menschen
Wenige Tage später, am 12. August 2014, erklärte die WHO – erstmals in ihrer Geschichte – den Einsatz experimenteller, jedoch noch nicht zugelassener Wirkstoffe zur Bekämpfung der Epidemie für ethisch vertretbar. „Das waren die ersten Antikörper, die beim Menschen in diesem Zusammenhang eingesetzt wurden. Wir arbeiteten schon seit Jahren daran, ohne auf großes Interesse zu stoßen. Nun konnte es nicht schnell genug gehen“, erinnert sich Steinkellner. Das öffentliche Interesse an ihrer Forschung stieg sprunghaft an, denn die Wurzeln des Ebola-Medikaments „ZMapp“ wuchsen in ihrem Labor.
„Erstmals wurden in Pflanzen produzierte Antikörper beim Menschen gegen Ebola eingesetzt.“

Antikörper gegen SARS-CoV-2
Sechs Jahre später taucht ein neues Virus auf, das nun schon seit zwei Jahren die Welt in Schach hält. Herta Steinkellner lässt abermals aufhorchen: Ihrer Forschungsgruppe ist es gelungen, Antikörper gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 zu erzeugen. Dabei handelt es sich um zwei Subtypen von Antikörpern, die hochinteressant sind, sogenannte IgG3-Antikörper und IgA-Antikörper. Letztere sind dahingehend vielversprechend, weil sie in den Schleimhäuten – also den Zutrittspforten von SARS-CoV-2 – aktiv sind und eine Therapie über Nasensprays ermöglichen könnten. „Hier sind schon finanzkräftige Unternehmen aktiv“, beurteilt sie die Anwendungsseite.
„Der IgG3-Antikörper-Subtyp ist 50-fach besser im Neutralisieren des Covid-19-Virus.“
50-fach besser im Kampf gegen das Virus
Noch interessanter sind die IgG3-Antikörper. „Diese sind sehr kompliziert in der Herstellung, mit viel Engagement der Mitarbeiter haben wir es aber geschafft“, berichtet die Biotechnologin vom bahnbrechenden Erfolg, für den sie den Patentschutz hält. Das Besondere an diesem Subtyp: „IgG3 ist 50-fach besser im Neutralisieren des Virus“, unterstreicht sie die hohe Wirksamkeit dieser Antikörper in der Bekämpfung des Coronavirus, die eine Studie im Fachblatt PNAS bestätigt hat. Das Problem ist allerdings die Instabilität des Antikörpers: „Im Moment ‚zerbröseln‘ sie binnen weniger Tage.“ Eine Hürde, die durch intensives Weiterforschen noch überwunden werden muss, damit es zu einem Herstellungsverfahren kommen kann.
Lehrerin, Ärztin oder Juristin
Steinkellners Weg in die Biotechnologie ist eigentlich dem Zufall zu verdanken – und Liebe auf den ersten Blick. Dass sie studieren möchte, weiß die Forscherin schon als Kind. Aufgewachsen in einem kleinen Kärntner Dorf gibt es für sie nur drei akademische Rollenmodelle: Lehrerin, Ärztin oder Juristin. Die heute 63-Jährige entscheidet sich für ein Lehramt der Biologie und geht Ende der 1970er-Jahre zum Studieren nach Wien.
Liebe auf den ersten Blick
Ein Nebenjob während des Studiums in einem genetischen Labor des AKH gibt ihr erstmals Einblicke in die faszinierende Welt der Genetik. „Hier sah ich zum ersten Mal: Eine Zelle sieht wirklich so aus, nicht nur im Buch“, erinnert sie sich an das Erweckungserlebnis, als das theoretisch Gelernte plötzlich real sichtbar wurde. Als Steinkellner in den 1980er-Jahren als junge studentische Hilfskraft ans Institut für Biotechnologie der Boku kommt, ist es „Liebe auf den ersten Blick“ und sie ist angesteckt von der dortigen Aufbruchstimmung. Sie fängt Feuer. Bis heute hält diese Faszination an.
Lebenslanges Mentoring
Nach ihrer Dissertation spezialisiert sich die junge Forscherin auf Molekularbiologie und findet im Gründer und damaligen Leiter Josef Glössl einen Mentor, der ihr neue Forschungsfelder aufzeigt und ein produktives Forschungsumfeld schafft. „Ich hatte und habe tolle Mitarbeiter:innen. Unsere Wissenschaft lebt von Teamarbeit und Vernetzung“, stellt sie fest. Ihre eigene spätere Rolle als Doktormutter sieht Steinkellner als „lebenslanges Mentoring“. So wurde sie vor kurzem von einem ehemaligen Postdoc, der seit zehn Jahren in den USA arbeitet, um ein Empfehlungsschreiben gebeten. „Ich bleibe für ewig und immer die Doktormutter“, lacht sie.

Talente zu wenig erkannt und gefördert
Einer ihrer ehemaligen Studierenden, der in den USA lebende Virologe Florian Krammer, hat während der Coronapandemie durch seine zahlreichen Interviews in den Medien breite Bekanntheit erlangt. Er gehört zu jenen exzellenten Wissenschaftler:innen, die in Österreich ausgebildet wurden, aber im Ausland Karriere machten. „Es ist schade, dass sich solche Top-Leute in Österreich oft wenig entfalten können“, bedauert Steinkellner. Einen der Gründe ortet sie darin, dass hierzulande Talente zu wenig erkannt und gefördert würden. Außerdem würde sie sich wünschen, dass es – wie in vielen westlichen Ländern – zu jeder Professur eine Basisfinanzierung für zusätzliche Mitarbeiter:innen gibt. „In Österreich fehlt das großteils. Dadurch fallen Viele, auch Talentierte, aus der Forschung, da es zu Finanzierungslücken kommen kann. Leider kann man so etwas schwer wieder aufholen“, sagt Steinkellner.
„Wir haben ein Finanzierungsloch zwischen Grundlagenforschung und Anwendung.“
Es braucht mehr Schnittstellen
Von 2010 bis 2017 leitete Steinkellner das Laura Bassi Exzellenzzentrum „Plant Produced Proteins“, in dem viele neue wissenschaftliche Werkzeuge entwickelt wurden, die dann erfolgreich in der angewandten Forschung Einzug fanden. Mehr solcher Schnittstellen zwischen Grundlagenforschung und Anwendung vermisst sie in Österreich. „Früher gab es beispielsweise die sogenannten Translational-Programme des FWF. Diese wichtige Förderschiene wurde jedoch eingestellt, wodurch ein großes Förderloch entstand. In jeder zweiten strategischen Diskussion taucht dieses strukturelle Problem auf.“
Networking und Teamarbeit
Jeder ihrer eigenen Forschungsaufenthalte in Großbritannien, den USA und Japan hat die Wissenschaftlerin geprägt. „Ich habe von überall etwas mitgebracht, das mich weitergebracht hat: ein neues Tool, Erfahrungen, aber auch weit verzweigte Personen-Netzwerke, von denen meine Forschungsgruppe bis heute profitiert“, erläutert sie. Networking und Teamarbeit hält Steinkellner für unverzichtbar in ihrer Disziplin. Ihre eigene Arbeit sieht sie als Ergebnis von vielen: von Vorgesetzten, die ein fruchtbares Umfeld schaffen, und von Mitarbeitenden, die Ideen umsetzen. Und sie bringt es auf den Punkt: „Einzelkämpfer:innen in meiner Disziplin sind passé!“