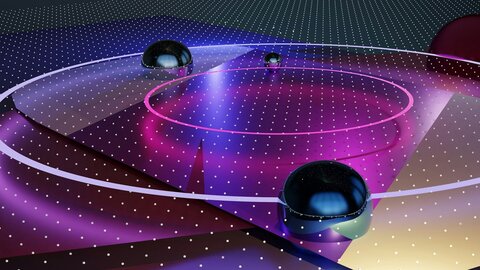Warum EU-Migrant:innen in Jobs unter ihrer Qualifikation landen

EU-Bürger:innen können sich in jedem Mitgliedsland der Union niederlassen und einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Dabei gilt das Recht auf Gleichbehandlung: Bei Bewerber:innen aus dem EU-Ausland dürfen keine Voraussetzungen verlangt werden, die nicht für Inländer:innen auch gelten würden. In der gelebten Realität sieht es mit der Gleichbehandlung allerdings ganz anders aus. Gerade viele Arbeitnehmer:innen, die aus östlichen EU-Ländern stammen, arbeiten in Jobs, die weit unter ihrem Ausbildungsniveau liegen.
Forschende sprechen hier von „Dequalifizierung“. In Österreich sind Migrant:innen laut Statistik um ein Vielfaches öfter davon betroffen als Inländer:innen. Das Projekt „Herstellung von Dequalifizierung bei ‚neuen‘ Migrant:innen“, das vom Wissenschaftsfonds FWF gefördert wird, untersucht als eine der ersten qualitativen soziologischen Forschungsarbeiten in diesem Bereich die Prozesse hinter dem verbreiteten Phänomen.
Elisabeth Scheibelhofer, Clara Holzinger und Anna-Katharina Draxl vom Institut für Soziologie der Universität Wien stellen dabei die Wahrnehmung der betroffenen Migrant:innen in den Fokus. „Der qualitative Ansatz des Projekts ist auch deshalb innovativ, weil er besondere Rücksicht auf die sensible Gesprächssituation bei den Interviews mit den Betroffenen nimmt und auf neue Art mit der Sprachbarriere umgeht“, hebt Scheibelhofer hervor.
Ungarn, Tschechien, Rumänien
Die Forscherinnen fokussieren auf drei Herkunftsländer, die im Zuge der „Osterweiterung“ 2004 und 2007 zur EU kamen: Ungarn, Tschechien und Rumänien. Dutzende Studienteilnehmer:innen aus diesen Staaten werden in drei Wellen, die zeitlich deutlich auseinanderliegen, ausführlich interviewt. „Unser Ansatz ist ungewöhnlich und ressourcenintensiv. In den wiederholten Interviews wird aber die Entstehung von Dequalifizierung als prozessualer Ablauf sichtbar“, betont Clara Holzinger.
Ein Grundproblem bei Befragungen dieser Art ist, dass interviewende Forschende und interviewte Zugewanderte Teil einer Gesellschaft mit inhärent diskriminierenden Strukturen sind. Machtverhältnisse zwischen Mehrheitsgesellschaft und Migrant:innen werden auch in solchen Situationen reproduziert. „Manche Interviewpartner:innen scheuen sich etwa davor, Diskriminierungserfahrungen direkt anzusprechen, weil das in ihren Augen eine Selbstbeschädigung bedeuten würde“, veranschaulicht Scheibelhofer eine der Folgen. „Stattdessen betonen sie ihre Dankbarkeit gegenüber dem Land, in das sie migriert sind – obwohl sie gar nicht danach gefragt wurden.“
Sensible Gesprächsführung
Soziale Mechanismen dieser Art benötigen eine sensible und offene Gesprächsführung sowie eine stark kontextorientierte Interpretation des Gesagten. Die Soziologinnen binden dafür ein Team von Dolmetsch- und Übersetzungs-Expert:innen eng in die Forschungsarbeit ein. „Wir wollten die Rolle der Dolmetschenden neu denken und sie nicht mehr nur als eine Art technisches Hilfsmittel zur Überwindung der Sprachbarriere betrachten, sondern als Teil der sozialen Interaktion in der Interviewsituation“, sagt Holzinger. Die Translationswissenschaftler:innen werden in der qualitativen Interviewführung eigens geschult und in die inhaltliche Reflexion und wissenschaftliche Interpretation des Gesagten eingebunden.
Die Interviewten können wählen, in welcher Sprache das Gespräch stattfinden soll. Aus den erzählten Lebenswegen lassen sich nicht nur vielfältige Diskriminierungserfahrungen ableiten. Neben den Folgen der Sprachbarriere bremsen zudem eine schleppende Anerkennung der im Herkunftsland absolvierten Ausbildung sowie der Mangel an informellen Netzwerken die Arbeitssuchenden aus. „Eine Naturwissenschaftlerin aus Tschechien erzählte etwa, dass sie unter anderem aus Mangel an Kinderbetreuungsmöglichkeiten ihrem erlernten Beruf nicht nachgehen kann. Nun arbeitet sie bereits seit einem Jahrzehnt als Assistenzkraft in einem Kindergarten“, gibt Holzinger ein Beispiel.
Übergangsjob als Dauereinrichtung
Ein weiteres Interview zeigt, wie die Verschärfung der Vorgaben für Deutschkenntnisse eine rumänische Ärztin zur Rückkehr in ihr Herkunftsland zwang. Eine andere, für ihren Job überqualifizierte Migrantin wurde von ihrer Kollegin diskriminiert, weil diese Angst hatte, ersetzt zu werden. Immer wieder wird erkennbar, wie trotz guter Deutschkenntnisse schlicht ein osteuropäischer Akzent Auslöser für Diskriminierungen ist.
„Ein zentraler Mechanismus der Dequalifizierung sind die fehlenden finanziellen Mittel, die die Migrant:innen zwingen, sofort nach ihrer Ankunft einer Arbeit nachzugehen“, erklärt Anna-Katharina Draxl. „Sie nehmen dann niedrigqualifizierte Jobs – vielleicht am Bau oder als Putzkraft – an, mit dem Plan, nach der Berufsanerkennung oder nach ausreichendem Spracherwerb zu einer der Ausbildung entsprechenden Arbeit zurückzukehren.“ Doch daraus wird oft nichts. Die Leute bleiben im schlechteren Job „stecken“ und werden auch vom Arbeitsmarktservice (AMS) immer wieder neu zu vergleichbaren Stellen vermittelt.
Diskriminierung reflektieren
Zu den Interviews mit den Migrant:innen kommen im Projekt Gespräche mit Vertreter:innen von Organisationen wie der Wirtschaftskammer oder dem AMS, um auch institutionelle Rahmenbedingungen abbilden zu können. Die wichtigste Maßnahme, die die Problematik der Dequalifizierung abmildern kann, liegt klar auf der Hand und wird von vielen Seiten immer wieder eingefordert: Dauer und Aufwand des Berufsanerkennungsprozesses müssen sinken. Gleichzeitig braucht es aber auch mehr Reflexion über diskriminierende Strukturen innerhalb der Wirtschaft und Gesellschaft.
Dazu tragen die Soziologinnen mit einer Citizen-Science-Initiative bei. Im Zusatzprojekt „Rassismen verstehen“, das vom Wissenschaftsfonds FWF im Rahmen des Programms „Top Citizen Science“ gefördert wird, werden Bürger:innen in die Interpretation der Interviews eingebunden. „Für uns ist dabei interessant, wie Menschen mit unterschiedlichem Background die Aussagen mit möglichen Diskriminierungserfahrungen wahrnehmen“, sagt Draxl.
Zu den Personen
Elisabeth Scheibelhofer ist Professorin am Institut für Soziologie der Universität Wien mit Forschungsschwerpunkten zu Migration, Mobilität und qualitativen Methoden. Im Projekt „Herstellung von Dequalifizierung bei ‚neuen‘ Migrant:innen“, das vom Wissenschaftsfonds FWF mit 399.000 Euro gefördert wird und bis 2025 läuft, arbeitet sie mit den Soziologinnen Clara Holzinger (Postdoc) und Anna-Katharina Draxl (Praedoc) zusammen, die beide zudem über Ausbildungen in den didaktischen Methoden von Deutsch als Fremdsprache (DaF) verfügen.
Publikationen
Holzinger C. & Draxl A.: Ein rassismuskritischer Blick auf sprachbezogene Diskriminierung beim Zugang zu wohlfahrtsstaatlichen Leistungen und am Arbeitsmarkt, in: Momentum Quarterly 2024
Scheibelhofer E., Holzinger C., Draxl A.: Confronting Racialised Power Asymmetries in the Interview Setting: Positioning Strategies of Highly Qualified Migrants, in: Social Inclusion 2023
Scheibelhofer E.: The Interpretive Interview. An Interview Form Centring on Research Participants' Constructions, in: International Journal of Qualitative Methods 2023
Mehr Informationen
Soziologinnen untersuchen die Phänomene, die dafür verantwortlich sind, dass zugewanderte Arbeitskräfte häufig unter ihrem Niveau arbeiten. Dazu arbeiten die Forschenden mit Migrant:innen zusammen und binden auch Bürger:innen ein.