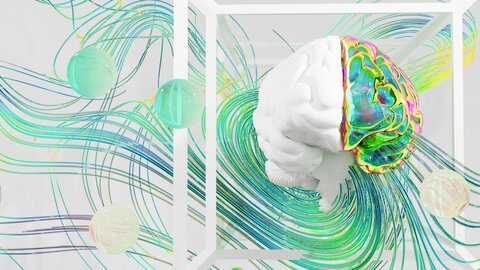Vereinbarkeit von Arbeit und Pflege: Win-win?

Rund 800.000 Österreicher:innen unterstützen und betreuen ihre älteren Angehörigen im Alltag zu Hause. Sie unterstützen bei technischen Fragen, kaufen ein, fahren zu Arztterminen oder helfen bei der Körperpflege. Die Mehrheit dieser Menschen ist nicht berufstätig – meist weil sie schon in Pension sind.
Dennoch ist die Zahl derer, die unterstützen, betreuen, pflegen und dabei weiter arbeiten gehen, hoch, sagt Karl Krajic, Soziologe von der Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt (FORBA): „Wir gehen davon aus, dass rund 300.000 Personen in Österreich versuchen, ihre Angehörigen zu unterstützen, zu betreuen oder direkt zu pflegen und gleichzeitig Erwerbsarbeit zu verrichten. Das ist eine beträchtliche Zahl.“ Ein Großteil dieser Menschen ist älter als 50 Jahre, rund drei Viertel davon sind Frauen. Sie eint ihr belastender Alltag. Je nach Betreuungsintensität wenden sie zwischen fünf und zwölf Wochenstunden zusätzlich zu Job, Haushalt und oft auch zur Betreuung der Enkel auf.
Im Rahmen des Forschungsprojektes „Combining employment with informal care for the aged (COMBECA)“ ging Krajic mit Kolleg:innen der Frage nach: Wie gehen Betriebe und Betroffene in den Betrieben mit der Vereinbarung von Pflege und Erwerbsarbeit um?
Das Forschungsprojekt COMBECA untersucht bestehende Maßnahmen und Aktivitäten von Betrieben zur Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenpflege.
Eine österreichisch-schweizerische Kooperation
Der Soziologe forscht mit der Politikwissenschaftlerin Ingrid Mairhuber und den Soziologinnen Viktoria Quehenberger und Charlotte Dötig (alle FORBA) sowie in Kooperation mit Forschenden der Fachhochschule Nordwestschweiz. Das Schweizer Team fokussierte auf ausgewählte Kantone, das österreichische auf die Bundesländer Wien, Niederösterreich, Steiermark und Vorarlberg. Gemeinsam entwickelten die beiden Teams Instrumente und stimmten das Forschungsdesign ab.
Nach der Analyse der relevanten Literatur interviewten sie Expert:innen aus Politik und Verwaltung und auch Personen, die Betriebe und Betroffene beraten. „Uns interessierte: Ist das Thema auch in ihren Organisationen angekommen? Und wie schätzen sie aus ihrer Außenperspektive die derzeitige Praxis in den Betrieben ein?“, erklärt Krajic.
Die unsichtbaren, belasteten Mitarbeitenden
Die Forschenden des COMBECA-Projekts wollten also herausfinden, welchen Stellenwert das Thema Vereinbarkeit von Pflege und Erwerbsarbeit in der Sozialpolitik und der sozialen Verwaltung hat. Das Ergebnis? „Es ist dort nicht sehr präsent, dass informelle Pflege zu einem beträchtlichen Teil auch mit Erwerbsarbeit verbunden wird“, so Krajic.
Im nächsten Schritt fanden die Forschenden fünf Betriebe, die zwischen 80 und 2.000 Mitarbeitende beschäftigten, welche bereit waren, an der Studie teilzunehmen. Einer war aus dem Bereich der Produktion, die anderen stammten aus dem sozialen und gesundheitlichen Dienstleistungssektor. Sie interviewten rund 50 Menschen: solche aus dem mittleren und oberen Management sowie Teamleiter:innen. „Aus den Gesprächen wurde uns zunächst klar: Die Betriebe haben wenig Information darüber, wie viele ihrer Mitarbeitenden betroffen sind“, erklärt Charlotte Dötig.
Mit berufstätigen, pflegenden Angehörigen und einigen Kolleg:innen führten die Forschenden Fokusgruppengespräche und biografische Interviews. Zusätzlich nahmen 500 Menschen aus den nternehmen an einer Online-Befragung teil – davon waren rund ein Drittel "pflegende Angehörige". Ein Ergebnis: Rund ein Viertel ist direkt mit Pflege im Alltag beschäftigt, etwa der Körperpflege ihrer Angehörigen. Drei Viertel unterstützen diese bei technischen und praktischen Fragen, beim Einkauf und vor allem auch im psychosozialen Bereich.
Die Diagnose Doppelbelastung trifft nicht immer zu
Ein Ergebnis, das vielleicht überraschen könnte, war, dass viele Betroffene ihre beruflichen Aufgaben so weit wie möglich weiterführen wollen. „Die Pflege ihrer Angehörigen ist ein schwieriges Thema, mit dem sie nicht offen hausieren gehen. Darum sind sie zufrieden, wenn sich Lösungen finden lassen, die in den Arbeitskontext passen. So verdienen sie, sind sozialversichert und zahlen Pensionsbeiträge“, erläutert Charlotte Dötig.
Das Finanzielle sei aber oft nur ein Teilaspekt. Denn ein Beruf bringt darüber hinaus auch sozialen Status, eine oft interessante Tätigkeit, Chancen für Erfolgserlebnisse und die Beteiligung in beruflichen und sozialen Netzwerken mit sich. „Es gab die Perspektive einer Frau, die meinte: Die Arbeit gibt mir Normalität. Sie tut mir gut. Deshalb will ich weiterarbeiten“, erzählt Dötig.
Aktuell sehe die Sozialpolitik pflegende Angehörige vorwiegend als ehrenamtliche Mitarbeitende, ohne die es nicht gehe, sagt Krajic. Zur Einordnung: Rund 70 Prozent der rund 500.000 Österreicher:innen, die Pflegegeld beziehen, werden vor allem von ihren Angehörigen zu Hause betreut. „Man fokussiert darauf, diese Menschen so weit zu unterstützen, dass sie möglichst weiter pflegen können, etwa mit Sozialversicherungsmöglichkeiten“, so der Soziologe. „Diese Instrumente befördern aber eher, aus dem Erwerbsleben auszusteigen – zur Vereinbarkeit tragen sie nur wenig bei.“
Das sei sicher im Sinne mancher pflegender Angehörigen. Viele Menschen, mit denen die Forschenden sprachen, wollen aber weiterarbeiten. „Wird die Vereinbarkeit gut unterstützt, kann Erwerbstätigkeit eine wichtige Ressource sein“, sagt Krajic. Dabei gibt es die Erwartung, dass Menschen mit Pflege und Beruf doppelt belastet sind. Das stimme dann, wenn Menschen nicht oder schlecht unterstützt werden. Wenn der Beruf mit der Pflege gut vereinbar ist, kann er auch enorm wichtige Momente der Entlastung von der fordernden Pflegetätigkeit schaffen, so das Fazit aus den Interviews.
Flexibilität als höchstes Gut
Damit das funktioniert, braucht es allerdings Kommunikation auf Augenhöhe und vor allem eines: Flexibilität. Denn wie viel und welche Unterstützung ein pflegebedürftiger Mensch braucht, ist von Situation zu Situation unterschiedlich. Der Pflegebedarf kann sich zudem schnell ändern, etwa durch einen Sturz oder eine akute Erkrankung. Wie gehen nun die erforschten Betriebe damit um?
„Wir haben gesehen, dass es sehr wenige formale Vorgaben gibt“, erläutert Krajic. Man nutzt die gesamte Palette an zeitlichen Vereinbarungen und passt diese individualisiert an die Situation an. Dabei kommen etablierte und erprobte Instrumente zum Einsatz: Gleit- oder Teilzeit etwa, Sonderurlaub oder Überstundenabbau. Auch Homeoffice, zumindest temporär, wurde mancherorts genutzt. Wenn möglich, passen Betriebe und Teams auch Aufgaben, Arbeitsprozesse und eingesetzte Personen an die Situation an.
Betriebe, so betonen die Forschenden, müssen es schaffen, Unterstützung für pflegende Mitarbeitende auch für deren Kolleg:innen fair zu gestalten. Wichtig sei die Unterstützung durch die Geschäftsführung und die Personalabteilung. „Die direkten Vorgesetzten in den Teams sind ganz zentral – denn diese müssen ja die Arbeitsprozesse organisieren“, erklärt Krajic.
Erwerbstätigkeit von Angehörigen zu unterstützen, kann viele Vorteile bringen: für die Betroffenen, die Betriebe, den Arbeitsmarkt und damit die Volkswirtschaft. Es existieren sozialpolitische Unterstützungselemente. Aber kaum eine:r der befragten Betroffenen entschied sich für Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit, für die es seit 2020 einen Rechtsanspruch gibt. Denn diese lässt sich laut den Befragten schwer mit den sich stetig ändernden pflegerischen Anforderungen vereinbaren. Karl Krajic sieht hier, im Sinne vieler Betroffenen, sozialpolitischen Handlungsbedarf hin zu alltagstauglichen, flexiblen Modellen. Zudem, so die Forschenden, ist es notwendig, die professionelle pflegerische und betreuerische Unterstützung auszubauen. Und es braucht viel mehr öffentliche Aufmerksamkeit: für berufstätige, pflegende Angehörige und die Betriebe, die ihnen die Vereinbarkeit ermöglichen.
Zu den Personen
Karl Krajic promovierte im Fach Soziologie und lehrt als Privatdozent an der Universität Wien und an anderen Hochschulen. Er forschte an den Ludwig Boltzmann Instituten für Medizin- und Gesundheitssoziologie und Health Promotion Research. In der Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt (FORBA) forscht Krajic unter anderem zur Gesundheitsförderung und Qualitätsentwicklung in der Altenbetreuung.
Charlotte Dötig ist Doktoratsstudentin an der Vienna Doctoral School of Social Science im Fach Soziologie. Seit 2016 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin bei FORBA und vereinbart Erwerbsarbeit mit Kindererziehung. Der Wissenschaftsfonds FWF hat das österreichisch-schweizerische Partnerprojekt COMBECA, das im Jänner 2025 ausläuft, mit 350.997 Euro gefördert.
Publikationen
Geisen T., Krajic K., Nideröst S. et al.: The relevance of the workplace for combining employment and informal care for older adults: results of a systematic literature review, in: International Journal of Care and Caring 2023
Krajic K., Dötig C., Mairhuber I., Quehenberger V.: Forschungsprojekt COMBECA – Combining Employment and Care for the Aged: Vorläufige Zusammenfassung der österreichischen Ergebnisse, FORBA-Forschungsbericht, Wien 2024