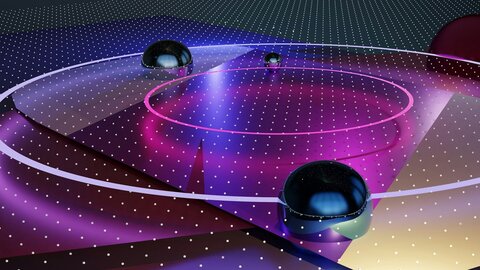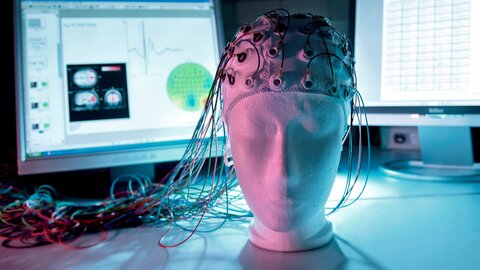Pragmatismus als (Über)Lebensstrategie

Das Image der Wohngegend spielt bei der Entscheidung, wo man sich niederlässt, für viele eine Rolle. Eilt ihr ein schlechter Ruf voraus, weichen jene, die die Möglichkeit haben, eher aus. Familien mit Migrationshintergrund haben jedoch mitunter keine Wahl, weshalb sie in strukturell benachteiligten Gegenden häufig die Mehrheit stellen. Inwiefern sich diese Rahmenbedingungen auf ihre Lebensbedingungen, sei es in punkto Bildung oder Arbeit auswirken, und welche Überlebensstrategien daraus resultieren, war Thema eines internationalen Forschungsprojekts unter der Leitung des Soziologen Erol Yildiz von der Universität Innsbruck. Neu am Forschungsfokus war der Blick auf die konkrete Familiensituation von Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern in Bezug auf deren Lebensbedingungen. Das ist bisher in der Migrationsforschung unbeachtet geblieben. Forscherteams der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt – an der Yildiz zum Zeitpunkt des Projekts beschäftigt war –, der Fachhochschule Nordwestschweiz und der Pädagogischen Hochschule Freiburg analysierten anhand von je zwei benachteiligten Wohngegenden auch vergleichend die Städte Klagenfurt, das schweizerische Basel und Freiburg in Deutschland.
Schlechter Ruf ist Makel
Das österreichische Team befasste sich mit einer Hochhaussiedlung (Fischl-Siedlung) und der Bahnhofsgegend in St. Ruprecht in Klagenfurt. Beide Gegenden haben einen schlechten Ruf. Zur ethnografischen Feldforschung flossen in jeder Stadt auch Gruppeninterviews mit acht Familien mit Migrationshintergrund sowie 16 Einzelinterviews mit einzelnen Familienmitgliedern in die Analyse ein. Wie die Wohngegend von den befragten Familien selbst wahrgenommen wird, hat sich gewandelt. Das ist ein Ergebnis der Studie. Mit dem schlechten Ruf ihrer Wohngegend sind die Bewohnerinnen und Bewohner dennoch immer wieder konfrontiert. „Die Jugendlichen, die dort aufgewachsen sind, gehen damit aber selbstbewusster um, als die ältere Generation“, sagt Yildiz. Letztere waren neu im Land, eher zurückhaltend und wegen der fehlenden Sprachkenntnisse auf Familienangehörige und Nachbarn angewiesen. Im Unterschied zu vielen Kindern von Einheimischen gingen die Kinder der Migrantenfamilien vor Ort zur Schule. Was sich auch in der Klassenzusammensetzung der beiden Schulen, wo das Team Interviews führte, spiegelte. Doch: Warum schicken sie ihre Kinder nicht auch woanders zur Schule?
Je unsicherer, desto pragmatischer
„Die erste Generation ist nicht auf die Idee gekommen. Sie hatte kein negatives Bild über diese Schulen. Außerdem sahen sie das Ganze pragmatisch und nutzten das Schulangebot, das da war“, erklärt Yildiz. Pragmatismus ist eine zentrale Lebensstrategie, ein weiteres Ergebnis, zu dem die Forschenden in allen drei Städten gelangten. Speziell Familien mit unsicherem rechtlichem Status, etwa Flüchtlinge, hätten eine pragmatische Lebensstrategie entwickelt. Bei der Teilstudie in Klagenfurt betraf das zwei der befragten Familien, eine davon war in den 1990ern aus Bosnien geflüchtet. Für alle seien die Diskriminierungserfahrungen, die mit dem rechtlichen Status einhergingen, das Hauptproblem gewesen, was es nicht leicht machte, trotzdem eine Perspektive zu entwickeln.
Lieber selbständig als ohne Job
Pragmatismus kann auch hilfreich sein, um nachteilige Erwerbssituationen in einer marginalisierten Wohngegend zu meistern. Viele zugewanderte Familien entschieden sich für die Selbstständigkeit und führen vor Ort kleine Geschäfte oder Imbissbuden. „Vor allem in St. Ruprecht, der Bahnhofsgegend, gibt es sonst wenige Arbeitsmöglichkeiten. Für viele ist Unternehmertum daher die einzige Erwerbsmöglichkeit“, sagt Yildiz im Gespräch mit scilog. Informelle Netzwerke vor Ort, vor allem Familienangehörige und auch Nachbarn, erleichtern den oft schwierigen Jobeinstieg. Man müsse bedenken, so der Forscher, dass mit dem Ende der staatlich geförderten Arbeitsmigration diese zu einer privat organisierten Angelegenheit wurde. Das Netzwerk Familie bekam einen größeren Stellenwert. Als Beispiel erzählt Erol Yildiz von einem Bosnier, der sich im Baugewerbe selbstständig machte. Für Angehörige und Bekannte, die nach ihm nach Klagenfurt kamen, fungierte er als Arbeitgeber oder unterstützte mit Erfahrung und Wissen. Diese Vorbild- und Ratgeberfunktion übernahmen später jene Kinder und Enkel, die hier einen höheren Bildungsabschluss schafften, wie die Analyse zeigte.
Diversitätspolitik hat positiven Effekt
Der hohe Stellenwert von Familienangehörigen hat aber auch seine Schattenseiten. Laut dem Soziologen hat es bei den Gruppeninterviews durchaus Tabuthemen gegeben. Kritik an gängigen Praktiken, etwa in punkto Familiennachzug oder Heirat, wurde eher in Einzelinterviews laut, vorrangig von den Töchtern. Was die zentralen Lebensstrategien – Pragmatismus, Präferenz für Selbstständigkeit, Nutzung informeller Netzwerke – betrifft, hat das Forschungsprojekt viele Parallelen zwischen den drei Städten aufgezeigt. Wobei Basel hervorsticht: Im Untersuchungszeitraum (2012-2015) bot die Stadtpolitik auf Basis einer offiziellen Diversitätspolitik mehr formelle Unterstützung beim Ankommen, als dies in Freiburg oder Klagenfurt der Fall war. Die vergleichende Analyse der Interviews zeigte, dass sich dies speziell bei den Themen Bildung und Erwerb positiv niederschlug. Fazit: Trotz des schlechten Rufs der Wohngegend und der strukturellen Nachteile konnten auch Familien mit Migrationshintergrund eigene Lebensstrategien entwickeln, um für die Nachkommen bessere Startbedingungen und mehr Wahlmöglichkeiten zu schaffen.
Zur Person Erol Yildiz leitet das Institut für Erziehungswissenschaft an der Universität Innsbruck. Er habilitierte in Soziologie an der Universität zu Köln. Einer seiner Forschungsschwerpunkte sind Migration und Urbanität. Von 2008 bis 2014 war Yildiz Professor für Interkulturelle Bildung an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt.
Publikationen