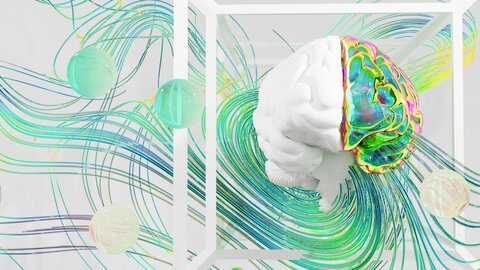Von digitalen Notenblättern bis zu Online-Strickrunden
Die Menge an kreativen digitalen Lösungen überraschte das wissenschaftliche Team: Sportvereine schauten via Zoom-Meetings gemeinsam Fußballspiele an oder organisierten Trainings-Challenges online, wo die Teammitglieder, nachdem sie alleine ihren Trainingslauf absolviert hatten, ihre Ergebnisse über eine App teilen konnten. Blasmusikkapellen digitalisierten ihre Notenblätter, eine Jugendgruppe hatte eine Schnitzeljagd-App für die Firmvorbereitung umfunktioniert.
Dass jede Altersgruppe mit digitalen Lösungen umgehen kann, bewiesen u. a. die Goldhauben, erklärt Griesbeck: „Das ist eine oberösterreichische Tradition, die als handwerkliches Netzwerk von Frauen begonnen hat. Viele Mitglieder sind auch noch mit 80 Jahren aktiv dabei.“ Gemeinsam reparieren sie Goldhauben, denn diese kunstvollen Kopfbedeckungen sind ein Teil der Trachtenkultur, außerdem engagieren sich die Gruppen in Sozialprojekten. „Während der Pandemie organisierten die Goldhauben zum Beispiel Online-Stickrunden und alle Frauen kamen mit den digitalen Lösungen klar“, ergänzt Griesbeck.
Beim Projektteam gemeldet hat sich auch das Linzer Start-up „Vereinsplaner“: Damit Vereine sich besser organisieren können, entwickelt man digitale Lösungen zur Mitgliederverwaltung oder im Finanzbereich. So entstand für das Team um Meyer die Möglichkeit, seine wissenschaftliche Expertise statt (wie ursprünglich geplant) in einem Laborbeispiel direkt in der Praxis einzubringen. In einem weiteren Praxisprojekt wurde die Entwicklung einer App begleitet, die es engagierten Personen in einer Gemeinde erleichtert, gemeinsame Projekte durchzuführen. Initiiert wurde diese App-Entwicklung mit dem Namen LENIE (Leben in Niederösterreich) vom Land Niederösterreich.
Digitalen Tools fehlt die latente Funktion
Trotz der Vielfalt an digitalen Lösungen blieben überraschenderweise wenige übrig, die nach der Pandemie weiter genutzt werden. Die häufig geäußerte Erklärung, dass es vielen Menschen und insbesondere Älteren an technischer Kompetenz fehlen könne, erwies sich als falsch. Mit seinem Team erforschte Uli Meyer die Ursachen: „Vereine haben eine offensichtliche Funktion, wie gemeinsames Musizieren, Singen oder bei den Goldhauben gemeinsames Sticken. Der Soziologe Robert Merton nennt das die manifeste Funktion. Es gibt jedoch auch eine latente Funktion, das ist die Gemeinschaft im Verein, die aber nicht so sichtbar ist.“
Wie sehr Gemeinschaft zählt, zeigte u. a. ein Besuch bei einer Tagung evangelischer Geistlicher, wo ein Tool zur Koordination von Ehrenamtlichen präsentiert wurde. Danach meinte ein Pfarrer kritisch, es ginge bei Ehrenämtern nicht um Effizienz, die Ehrenamtlichen würden vielmehr das persönliche Telefonat mit dem Pfarrer bevorzugen, denn so könnten sie im Austausch bleiben und Wertschätzung erfahren. Für Meyer eine Bestätigung: „Die latente Funktion des persönlichen Zusammenhalts wurde bei der Gestaltung digitaler Lösungen zumeist nicht berücksichtigt. Viele Tools gingen schlicht am Bedarf der Menschen vorbei. Was geblieben ist und weiterhin genutzt wird, sind Tools mit administrativen, also manifesten Aufgaben, wie das Bereitstellen von Noten oder die Mitgliederverwaltung.“