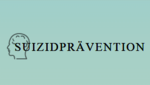Hoffnung auf Klicks: Mit Websites Menschen in Krisen erreichen

„Wenn man bei Google Begriffe wie Suizid oder Suizidhilfe eingibt, erscheinen unzählige Ressourcen“, sagt Benedikt Till vom Zentrum für Public Health der Medizinischen Universität Wien. „Aber wir wissen praktisch nichts darüber, wie diese Webseiten wirken, welche Inhalte Betroffene konsumieren und welche sie meiden.“ Die Webseiten variieren sowohl inhaltlich als auch im Design, was ihre Bewertung schwierig macht. Zum Beispiel stellt sich die Frage, ob eine Webseite zur Suizidprävention aufmunternd und hoffnungsvoll gestaltet sein sollte, um eine negative Stimmung zu vermeiden – oder ob ein solcher Ansatz kontraproduktiv ist? „Ein fröhliches Design hebt vielleicht die Stimmung, aber spricht Betroffene womöglich gar nicht an“, erklärt der Psychologe und Suizidforscher. „Ein dunkleres Design wiederum kann zusätzlich belasten.“
Fakten, Hilfe, Bewältigung
Um dieser Komplexität gerecht zu werden, entwickelte ein Team um Till in dem vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Forschungsprojekt „Suizidpräventionswebseiten und ihre Wirkung“ verschiedene Webseiten. „Wir haben von einer Agentur unterschiedliche Typen von Webseiten in vielen verschiedenen Designs entwickeln lassen“, erzählt der Projektleiter. Anschließend wurden die jeweiligen Pilotmodelle mit unterschiedlichen Zielgruppen diskutiert: Betroffene, Angehörige, Expert:innen für Suizidprävention und Kommunikation (z. B. Webdesigner:innen) bewerteten die Inhalte und ihre Wirkung. Auf Basis dieses Feedbacks reduzierte das Forschungsteam die Auswahl auf drei Internetauftritte.
Die drei Webseiten sind bereits seit dem 9. September 2024 – einem Tag vor dem World Suicide Prevention Day der WHO – online. Über Cookies werden anonymisiert Daten über das Nutzerverhalten der Besucher:innen auf den Webseiten erhoben, wie zum Beispiel Mausbewegungen, Klickpfade, Verweildauer oder Scrollverhalten. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, einen Online-Fragebogen auszufüllen. „So haben wir zwei Datenquellen: das Nutzerverhalten und die Selbstauskünfte“, sagt Till. „Damit wollen wir herausfinden, welche Webseite am besten wirkt.“
Krisenbewältigung
Suizid ist ein Thema, über das viele Menschen im Laufe ihres Lebens nachdenken. Er zählt bei Frauen und Männern bis zum 50. Lebensjahr zu einer der häufigsten Todesursachen. Ein Forschungsprojekt des FWF widmet sich der Suizidprävention im Internet. Auf der Projektseite finden Sie Hilfe, Beratung und Informationen zum Thema.
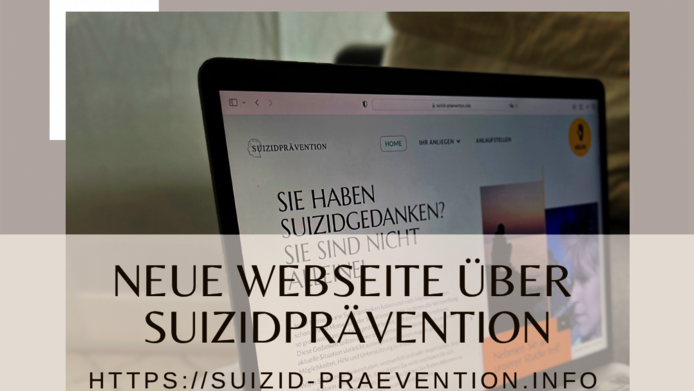
Ein neuer Blick auf Medienwirkung
Im Zentrum steht die Frage, welche Inhalte Hoffnung bei der Bewältigung von suizidalen Krisen vermitteln können und damit möglicherweise einen sogenannten Papageno-Effekt auslösen. Dieser steht im Gegensatz zum bekannten Werther-Effekt, benannt nach Goethes „Leiden des jungen Werther“. „Damals wie heute konnte man beobachten, dass nach sensationsträchtigen Suizidberichten die Suizidrate anstieg“, sagt Till. Der Werther-Effekt ist wissenschaftlich gut dokumentiert und eine der Grundlagen für die Medienempfehlungen zur Suizidberichterstattung, die 1987 erstmals in Österreich veröffentlicht wurden. „Die Journalist:innen haben das damals erstaunlich gut umgesetzt“, sagt der Suizidforscher. Seither gilt Österreich als Vorreiter: Die Empfehlungen wurden in den Pressekodex aufgenommen und die Zusammenarbeit zwischen Medien und Präventionsexpert:innen gilt international als vorbildlich.
Umgekehrt steht der Papageno-Effekt für einen positiven Einfluss medialer Inhalte. „Wenn eine Person öffentlich schildert, wie sie sich Hilfe gesucht hat und was ihr in der Krise geholfen hat, dann wirkt das schützend“, erklärt Till. „Solche Geschichten können suizidale Gedanken reduzieren.“ Der Begriff leitet sich aus Mozarts Zauberflöte ab: Dort will sich Papageno aus Verzweiflung das Leben nehmen, wird aber im letzten Moment daran gehindert.
KI in der Suizidprävention
In der Suizidprävention spielt inzwischen auch künstliche Intelligenz eine Rolle. „Wir haben KI in einem anderen Projekt explorativ getestet, jedoch mit gemischten Ergebnissen“, berichtet Till. Wenn Nutzer:innen nach Hilfe suchten, habe die KI vorbildlich reagiert. Schwieriger wurde es, wenn sie simulierten, Journalist:innen zu sein, die über einen Suizid berichten wollen. „Da wurden etwa Suizidmethoden viel zu detailliert beschrieben, entgegen allen Empfehlungen.“ Obwohl sich das Modell durch Hinweise kaum korrigieren ließ, sieht Till auch hier Potenzial: „KI kann problematisch sein, aber auch helfen, etwa beim Training von Gesprächssituationen. Es kommt darauf an, wie man sie einsetzt.“
Die Forschungsarbeit von Wissenschaftler:innen wie Benedikt Till und dessen Kollegen Thomas Niederkrotenthaler an der Medizinischen Universität Wien ebnet den Weg zu wirksamer digitaler Suizidprävention. Noch steht man am Beginn, doch Österreich hat nicht nur medienethisch, sondern auch in der Forschung international eine führende Rolle übernommen. Am Ende zählt, wie zuverlässig und in welcher Form Webseiten für Betroffene wirksame Hilfsangebote in Zeiten großer Bedrängnis sind. „Ob ein bestimmtes Design oder eine Geschichte oder beides Hoffnung schenkt, das wissen wir nur, wenn wir es empirisch untersuchen“, sagt Till. Noch wird das Klick- und Surfverhalten der Nutzer:innen bis zum Projektende im Frühjahr 2027 erfasst. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse können die Möglichkeiten suizidpräventiver Maßnahmen in die digitale Welt und im Idealfall direkt in die dunklen Räume der Betroffenen befördern.
An der Studie teilnehmen
Es sind alle deutschsprachigen Internetnutzer:innen dazu eingeladen, die Suizidpräventionswebseite des aktuellen Projekts unter https://suizid-praevention.info aufzurufen und sich ein Bild vom Design und den Inhalten der Webseite zu machen. Die Forschenden fordern Interessierte aus unterschiedlichen Zielgruppen (Personen mit Suizidgedanken, Personen, die sich um jemanden mit Suizidgedanken sorgen, die jemanden durch Suizid verloren haben oder sich aus anderen Gründen für Suizidprävention interessieren) ausdrücklich auf, an der Befragung teilzunehmen.
Zur Person
Benedikt Till ist assoziierter Professor an der Abteilung für Sozial- und Präventivmedizin, Zentrum für Public Health, der Medizinischen Universität Wien. Er absolvierte sein Doktorat in Psychologie an der Universität Wien und arbeitet aktuell im Bereich Suizidforschung, Public Mental Health, Gesundheitskommunikation und Medienpsychologie. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der Rolle der Massenmedien bei Suizid und Suizidprävention. Darüber hinaus ist er Gründungsmitglied und Schriftführer der Wiener Werkstätte für Suizidforschung und seit 2024 nationaler Vertreter der International Association for Suicide Prevention (IASP) in Österreich.
Publikationen
Content analysis of suicide-related online portrayals: changes in contents retrieved with search engines in the United States and Austria from 2013 to 2018, in: Journal of Affective Disorders 2020
Effect of educative suicide prevention news articles featuring experts with vs without personal experience of suicidal ideation: A randomized controlled trial of the Papageno effect, in: Journal of Clinical Psychiatry 2018
Beneficial and harmful effects of educative suicide prevention websites: randomised controlled trial exploring Papageno v. Werther effects, in: British Journal of Psychiatry 2017