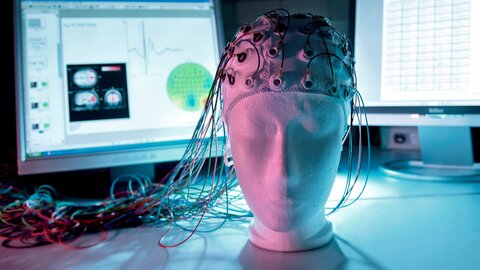Grünes Licht für die Angstforschung

„Auslöschung“ (extinction) ist eine klassische Methode der Angsttherapie: Erinnerungen an negative – angsterzeugende – Erfahrungen werden dabei durch wiederholte positive Erlebnisse, also durch neues Lernen, quasi überschrieben. Wer von einem Hund gebissen wurde, hat Angst vor Hunden. Wer danach aber viele problemlose Begegnungen mit Hunden hat, kann so die Angst besiegen. So einfach das klingt, und so effizient es auch helfen kann –, nicht für jede Person klappt das gleich gut. Warum das so ist und was man dagegen tun kann, interessierte den Pharmazeuten Nicolas Singewald von der Universität Innsbruck in dem FWF-Projekt „Epigenetische Mechanismen gestörter Gedächtnisregulation“ des Spezialforschungsbereichs „Cell signaling in chronic CNS disorders“.
Acetyl gegen Angst
Ganz speziell fokussierte das Team um Singewald dabei auf epigenetische Effekte, also Veränderungen des Erbguts, die im Laufe eines Lebens erworben werden. Konkret untersuchten sie eine chemische Veränderung (Acetylierung) von bestimmten DNA-assoziierten Proteinen (Histone), für die es Hinweise gibt, dass sie Angstauslöschung positiv beeinflusst. Singewalds Team gelang nun nicht nur der Nachweis, dass diese chemische Modifikation eine gestörte Angstauslöschung stärken und korrigieren kann, sondern gemeinsam mit internationalen Kolleginnen und Kollegen konnte das Forscherteam in Innsbruck auch wichtige zelluläre Mechanismen identifizieren, die dazu beitragen.
Angsthasen unter den Mäusen
Wesentlich für die Arbeit der Forschungsgruppe Neuropharmakologie um Nicolas Singewald war ein ganz bestimmter Mausstamm (129S1/SvlmJ), den die Forscherinnen und Forscher zuvor zusammen mit dem US-Hirnforscher Andrew Holmes identifiziert hatten. Dieser Stamm besitzt - ähnlich wie bei Angstpatienten - eine eingeschränkte Fähigkeit zur Angstauslöschung und erlaubte es der Gruppe so, die zellulären und molekularen Mechanismen zu identifizieren, die eine Angsttherapie fördern können. Tatsächlich konnten die Forscherinnen und Forscher zunächst zeigen, dass eine verstärkte Acetylierung von Histonen die Angstauslöschung in diesen Mäusen förderte – es also einen ganz klaren Zusammenhang zwischen epigenetischen Modifikationen und Korrektur gestörter Auslöschung gibt. Welche zellulären und molekularen Prozesse dazu beitragen, entschlüsselte die Gruppe dann in weiteren überzeugenden Experimenten.

Verwaiste Rezeptoren
So gelang es dem Forscherteam zu zeigen, dass nach der Acetylierung der Histone ganz bestimmte Gene an der Angstauslöschung beteiligt werden. "Tatsächlich fanden wir die Beteiligung von Genen, deren Genprodukte die Plastizität von Nervenenden – den Synapsen – beeinflussen. Zusätzlich entdeckten wir, dass Gene für bisher gänzlich unbekannte Rezeptoren eine Rolle spielten. Jetzt fragen wir uns, welche Botenstoffe wohl diese Rezeptoren aktivieren", erläutert Singewald die Ergebnisse. In zusätzlichen Studien wurden noch weitere molekulare Player entdeckt, die einen Einfluss auf Angstauslöschung haben könnten: RNAs. Für gewöhnlich sorgen diese für die Übersetzung genetischer Codes in den Aufbau von Proteinen. Doch seit langem ist bekannt, dass es auch RNAs mit anderen Funktionen gibt. Genau solche RNAs (ncRNAs und miRNAs) waren es, die Nicolas Singewald und Kooperationspartner innerhalb des FWF-Spezialforschungsbereichs (SFB) als Beteiligte bei der Angstauslöschung identifizieren konnten.
Therapiekonzept
Doch auch die Beteiligung von Rezeptoren, die durch bestimmte Neurotransmitter, wie zum Beispiel Dopamin aktiviert werden, wurde entdeckt. Daraus leitete das Team auch ein Konzept zur Behandlung von gestörter Auslöschung ab, das möglicherweise für den Menschen nutzbar wäre. Dazu Singewald: „Für die Überprüfung dieses Behandlungskonzepts machten wir uns zunutze, dass es ein zugelassenes (Parkinson)-Medikament gibt, das einen aktivierenden Einfluss auf Dopamin-abhängige Signalwege ausübt.“ Gemeinsam mit internationalen Kolleginnen und Kollegen konnten damit durchaus überzeugende Ergebnisse erzielt werden, wie Singewald darlegt: „Wir konnten sowohl im Mausmodell als auch zunächst an gesunden Menschen zeigen, dass dieses Therapiekonzept langanhaltend wirken könnte.“ Insgesamt deuten die Ergebnisse dieses Projekts des Wissenschaftsfonds FWF an, dass die Verstärkung bestimmter zellulärer und (epi)genetischer Vorgänge einen neuen Ansatz in der Angsttherapie darstellt. Personen, bei denen Therapiekonzepte auf Basis von Angstauslöschung, wie zum Beispiel bei der Expositionstherapie, nicht optimal funktionieren, können nun neue Hoffnung schöpfen, zukünftig ihren krankhaften Ängsten effektiver beizukommen.
Zur Person Nicolas Singewald leitet die Neuropharmacology Unit am Department of Pharmacology and Toxicology der Universität Innsbruck. Sein Arbeitschwerpunkt liegt in den Bereichen der neuronalen Signalverarbeitung sowie der Entwicklung neuer Therapiekonzepte bei neuropsychiatrischen Erkrankungen. Als Erwin-Schrödinger-Stipendiat des FWF konnte er in den frühen Jahren seiner Laufbahn am Department of Clinical Pharmacology der Universität Oxford, Großbritannien, internationale Erfahrungen sammeln.
Projektwebsite Cell signaling in chronic CNS disorders Publikationen