Frankreich zwischen Ausnahme und Normalität
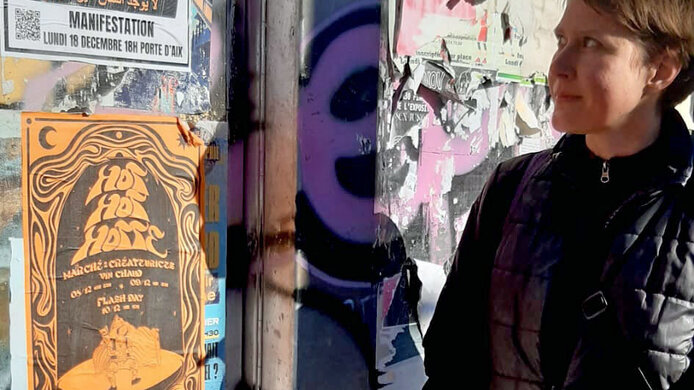
In meinem Schrödinger-Projekt beschäftige ich mich mit dem repressiven Umgang von Polizei und Justiz im Kontext von Protest sowie mit Darstellungen in Medien (Massenmedien und soziale Medien) in den vergangenen Jahren in Frankreich. Dabei interessiere ich mich für die Frage, wie diese mit Ausnahmezuständen in Verbindung stehen. Mein Interesse an Ausnahmezuständen fußt sowohl auf einem wissenschaftlichen als auch persönlichen Grund. Ich selbst erlebte die Auswirkungen des „antiterroristischen“ Ausnahmezustandes von 2015 bis 2017, der nach den Attentaten in Paris und Saint-Denis verhängt wurde, auf Protest mit. Dieser Ausnahmezustand hatte auch Einschränkungen der Versammlungsfreiheit zur Folge.
Fragend von einem Protest zum anderen
Seitdem hat sich viel getan: Bewegungen haben sich weiterentwickelt, es gab einen „Gesundheitsnotstand“ im Zuge der Coronapandemie und Polizeigewalt prägt, unabhängig von Ausnahmezuständen, den Protestalltag. Als ich Anfang April 2023 in Paris ankam, waren die Proteste gegen die mittlerweile verabschiedete Rentenreform in vollem Gange. Im Juni 2023 wurde Nawel Merzouk, ein französisch-algerischer Jugendlicher, bei einer Verkehrskontrolle von einem Polizeibeamten in Nanterre erschossen. Daraufhin kam es in verschiedenen französischen Städten zu Revolten, auf die wiederum Repression durch Polizei und Justiz folgten.
Diese Eindrücke und die von mir geführten Interviews mit Expert:innen aus der Sozial- und Rechtswissenschaft sowie Gespräche mit Jurist:innen veränder(te)n meine Forschungsperspektive. Denn neben „harter Repression“ gibt es auch so etwas wie „sanfte Repression“: Dazu zählen etwa fehlende materielle Ressourcen und fehlende Orte, um sich zu organisieren. Ebenso wie die mediale Delegitimierung von Bewegungen gegen „Islamophobie“ oder „radikalem“ Klimaaktivismus. Weiters sind im Zuge der im Sommer 2024 stattfindenden olympischen Sommerspiele in Paris und Marseille neue Ausnahmezustände und Proteste zu erwarten. Bisher streikten schon undokumentiert Arbeitende auf Baustellen in Paris und Sicherheitsbestimmungen wurden verschärft. Unter anderem wird auch die algorithmische Videoüberwachung während der Spiele ausprobiert.
Zwischen Paris und Marseille
Begonnen habe ich mit meinen Forschungen in Marseille. Diese Entscheidung habe ich wegen bereits bestehender sozialer und aktivistischer Kontakte getroffen. Für qualitative Forschungen ist das unabdinglich. So kann ich sowohl an den hybriden Seminaren am CESDIP teilnehmen als auch an meiner Forschung arbeiten. Am CESDIP entschied ich mich für das renommierte Forschungsinstitut der Strafrechtssoziologie aufgrund seiner langjährigen Expertise im Bereich des Protest Policing und der dort tätigen Forschenden, vor allem Fabien Jobard, der als gastgebender Wissenschaftler fungiert. Die interdisziplinäre Ausrichtung des CESDIP erlaubt es mir, mich mit für mich teils neuen Ansätzen der Kriminal- und Strafrechtssoziologie auseinanderzusetzen und diese mit politikwissenschaftlichen und postkolonialen Ansätzen zu verbinden.
Viel Raum für Austausch
Vonseiten der Leitung (Jacques de Maillard und Mathilde Darley) herrscht ein sehr angenehmes Arbeitsklima, das viel Freiraum, aber auch Raum für Kooperationen ermöglicht. Einen schönen Rahmen für Austausch bilden die regelmäßigen Seminare, bei denen ganz in französischer Manier anschließend gemeinsam gegessen wird. Das habe ich sehr zu schätzen gelernt. Die Fahrt zwischen Paris und Marseille erscheint mit dem TGV kurz – es sind lediglich 3,5 Stunden. Gleichzeitig sind es Reisen durch Welten: zwischen Instituts- und Forschungsalltag, zwischen „Metropole“ und „Peripherie“, zwischen Norden und Süden. Immer wieder komme ich gerne in Marseille an. Dort lasse ich meine Gedanken beim Wandern durch die Calanques, die Buchten, (ab)schweifen.





