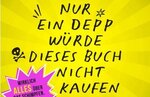Lesetipp
Das Buch „Nur ein Depp würde dieses Buch nicht kaufen“ von Oksana Haryliv hält auf amüsante Art alles fest, was man über das Schimpfen wissen muss.

„Schleich di, du Oaschloch!“ Diese Beschimpfung, die ein Wiener dem Terroristen nach dem Anschlag vom 2. November 2020 in der Wiener Innenstadt hinterherrief, ging viral und wurde zum Spruch des Jahres. Für Oksana Havryliv ein Beispiel, das zeigt, wie eine vulgäre Beschimpfung – zunächst als Abwehrreaktion – schließlich Zusammenhalt und Solidarität erzeugen kann. Sie habe den Spruch sogar auf einem Kipferl in der Vitrine einer Konditorei gesehen, erzählt die aus der Ukraine stammende Germanistin.
Widerstand leisten und Zusammenhalt erzeugen, das sind zwei jener insgesamt über 20 Funktionen, die die ausgewiesene Schimpfforscherin in ihren Untersuchungen finden konnte. Seit 30 Jahren erforscht sie verbale Aggression im Wienerischen. Warum schimpfen wir? Wie hat sich das Schimpfen über die Zeit und zwischen den Generationen verändert und welche unterschiedlichen Schimpfkulturen gibt es in verschiedenen Sprachen? Soeben ist ihr neues populärwissenschaftliches Werk „Nur ein Depp würde dieses Buch nicht kaufen“ erschienen, in dem sie auf sehr anschauliche und humorvolle Art ihre Forschungsergebnisse zusammenfasst.
Seit die Germanistin 1994 mit einem ÖAD-Stipendium zum ersten Mal in Wien war, hat sie das Thema nicht mehr losgelassen. Sie war sofort angetan vom Wiener Dialekt und dessen reichem Schimpfwortschatz, erzählt die heute 52-Jährige. Wie man in dieser Stadt sprach, war so anders als das Deutsch, das sie bis dahin gelernt und gehört hatte. In ihrer Heimatstadt Lwiw hat die deutsche Sprache eine lange Tradition. Das ehemalige Lemberg war Teil der k. u. k. Monarchie – in der Westukraine gibt es dafür den scherzhaft-liebevollen Ausdruck „zu Zeiten von Oma Österreich“.

Havryliv besucht eine Schule mit erweitertem Deutschunterricht, wo sie bereits mit sieben Jahren beginnt, die Sprache zu lernen. Reisen ist damals zu Sowjetzeiten unmöglich und die Fremdsprache für sie somit der Schlüssel zur Welt. Denn damit wird ihr möglich, schon als Kind als Austauschschülerin in die DDR zu reisen.
Eine Erfahrung, die ihren weiteren Lebensweg prägen sollte. „Die DDR war für mich damals im Vergleich zur UdSSR viel bunter. Auf der Straße sah man Punks mit bunten Haaren, Kaugummi kauend. Das war der Wilde Westen!“, erinnert sie sich. In der Schule habe sie allerdings gelernt, wie froh sie sein könne, nicht im kapitalistischen Westen aufwachsen zu müssen, nicht in der Ausbeutung, sondern in der freien Sowjetunion. Als sie damals erstmals am Alexanderplatz in Berlin auf dem Fernsehturm steht und nach Westberlin sieht, kommen ihr erste Zweifel: „So viele Lichter, so bunt. Das kann doch nicht so schlimm sein dort“, schmunzelt die humorvolle Wissenschaftlerin.
„Die DDR war für mich der Wilde Westen.“
Der Plan steht fest: Germanistik studieren und als Reiseführerin in den sozialistischen Ländern unterwegs sein. Für die nötige Sprachpraxis während des Studiums an der Universität Lwiw sorgt sie mit viel Fantasie: Um Deutsch zu üben, marschiert sie mit Kolleg:innen in Studentenheime und lädt Studierende aus der DDR zu Partys ein. 1991 wird die Ukraine unabhängig. 1994 beginnt sie an ihrer Dissertation zum Thema Schimpfwörter in der modernen deutschsprachigen, mit Schwerpunkt auf österreichische Literatur zu schreiben – und stößt auf einen reichhaltigen Fundus bei Autor:innen wie Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek und Werner Schwab.
Als sie 1994 erstmals nach Wien kommt, ist sie nicht nur angetan von der Poesie des Wiener Dialekts, sie stößt auch auf einen weiteren wichtigen Aspekt: den alltäglichen Gebrauch von Schimpfwörtern. Dieser Ansatz ist neu. Bisher gab es nur wenige fundierte Untersuchungen über aggressive Sprechakte in der Alltagssprache, zu der nicht nur Beschimpfungen, sondern auch Flüche, brutale Aufforderungen, Drohungen und Verwünschungen gehören.
Mit einem vom FWF geförderten Lise-Meitner-Stipendium kann sie 2006 mit umfangreichen Feldstudien beginnen, die sie 2012 im Rahmen eines Elise-Richter-Projekts, ebenfalls vom FWF finanziert, fortsetzen kann. Ihr Befund: Schimpfen erfüllt ein breites Spektrum von Funktionen. Nur elf Prozent des Schimpfens dienen dabei tatsächlich dem Beleidigen. Am wichtigsten ist die kathartische Funktion, man will Dampf ablassen, das Schimpfen kann aber auch Zusammenhalt und Solidarität stärken oder einfach nur ein Pausenfüller sein. Während im Laufe der letzten zehn Jahre das Abreagieren negativer Emotionen zugenommen hat, ist der scherzhaft-kosende Gebrauch von Schimpfwörtern gesunken.
Der scherzhafte Gebrauch deftiger Sprache ist – vor allem unter Männern und Jugendlichen – zwar noch immer beliebt, signalisiert Verbundenheit und findet sich zum Beispiel bei der Begrüßung „Servas, du Wappler“ wieder. Besonders bei Jugendlichen übernimmt „grobe Sprache“ unterschiedliche Funktionen: wie etwa sich als überlegen zu positionieren, von anderen abzugrenzen, einander zu bestärken oder andere gezielt zu provozieren. Der scherzhafte Gebrauch kann auch Trost oder Bewunderung ausdrücken, wie etwa in dem anerkennenden „Du Luder!“ oder „Du gutmütiger Depp!“. Dass der humorvolle Gebrauch abnimmt, erklären die von Havryliv befragten WienerInnen damit, dass sie angesichts einer zunehmend multikulturellen Gesellschaft vorsichtiger mit urwienerischen Äußerungen geworden sind, weil sie befürchten – insbesondere von Menschen eines anderen Kulturkreises – falsch verstanden zu werden.
Grundsätzlich gilt, geschimpft und geflucht wird in allen Schichten und unabhängig vom Bildungsniveau. Aufgefasst wird das von den Betroffenen hingegen unterschiedlich. Frauen kränkt es eher, wenn ihr Aussehen beleidigt wird. Männer reagieren empfindlich, wenn ihre Leistung, ob beruflich oder sexuell, hinterfragt wird.
Wichtig ist der Forscherin, eine Trennlinie zwischen verbaler Aggression und verbaler Gewalt zu ziehen. Denn die beiden Begriffe werden oft als synonym betrachtet. „Verbale Gewalt ist ein breiteres Phänomen, sie kann auch ohne aggressive Sprechakte ausgeübt werden.“ Um für solche Unterschiede zu sensibilisieren, zum behutsamen Umgang mit der Sprache sowie der gewaltfreien Kommunikation zu bewegen und die Wirkungen des eigenen Sprachgebrauchs zu reflektieren, hält Havryliv auch Workshops an Schulen ab.
„Youtube, Rapp und Influencer:innen beeinflussen die Jugendsprache stark.“
In einem vom FWF geförderten Wissenschaftskommunikationsprojekt untersuchte sie zusammen mit den SchülerInnen Ursachen, Formen und Funktionen verbaler Aggressionen in Schulen. Gemeinsam mit zwölf Wiener Schulklassen erarbeitete sie in Workshops, wann und wie es verbale Aggression im Schulalltag gibt und wie man negative Gefühle loswerden kann, ohne zu beleidigen. Die Schüler:innen sammelten selbst Schimpfwörter, führten Interviews mit Schulkolleg:innen und diskutierten die Ergebnisse.
„Einen starken Einfluss haben hier Youtuber:innen, Rapper:innen und Influencer:innen“, stellt Havryliv fest. Während Jugendliche vor zehn Jahren noch mehr rassistische Schimpfworte verwendeten, die auf eine ethnische Zugehörigkeit anspielten, seien heute mit Bezeichnungen wie „Behinderte:r“ oder „Opfer“ geistige und körperliche Merkmale größere Angriffsflächen. „Jugendliche sind heute offenbar stärker für Herkunft sensibilisiert“, interpretiert sie das Ergebnis.
Eine wichtige Rolle im Schimpfwortschatz von Jugendlichen spielt Sexualität, etwa „Wichser“ oder „Hure“. Je bizarrer, umso beliebter, so Havryliv. Wobei es bei Jugendlichen – im Vergleich zu Erwachsenen – deutliche Geschlechtsunterschiede beim Schimpfen gibt: „Rituelle Mutterbeleidigungen kommen praktisch nur unter Buben vor und verschwinden nach der Schule wieder aus dem Sprachgebrauch“, sagt die Forscherin.
In den letzten Jahren legte Havryliv ihren Forschungsfokus besonders darauf, wie sich Vulgarismen in einer multikulturellen Gesellschaft verändern. Bestimmte Ausdrücke haben in verschiedenen Kulturen unterschiedliche Funktionen. So habe sich das Wort „Oida“ von einer Anrede zu einem Pausenfüller entwickelt, ähnlich dem „Fuck“ im angloamerikanischen Sprachraum. Wie sich Schimpfwortäußerung, -wahrnehmung, aber auch die Reaktion darauf in einer multikulturellen Gesellschaft verändern, sei theoretisch wenig erfasst. „Jede Kultur hat ihre eigenen Tabus. Es geht aber auch um Sensibilisierung und Gewaltprävention“, sagt die Wissenschaftlerin. So kann die neutrale oder auch positiv gemeinte Aussage „Deine Schwester ist hübsch“ als Beleidigung aufgefasst werden.
„In Krisenzeiten bilden sich Wortkreuzungen.“
Jeder kulturelle Raum hat seine eigene Schimpfkultur. Im deutschsprachigen Raum ist sie traditionell fäkal- und analfixiert, während im angloamerikanischen Raum, aber auch am Balkan sexualbezogene Wörter dominieren. In Ländern wie Italien und Spanien, wo der Einfluss der Kirche groß ist, dominiert hingegen eine sakrale Schimpfkultur, im Nahen Osten ist es die Verwandtenbeleidigung. Die Grenzen zwischen den „Schimpfkulturen“ sind fließend und hier kann man einen Wandel beobachten. „Durch den Einfluss von Filmen setzten sich bei uns Beschimpfungen wie ,,Fick deine Mutter‘ durch“, stellt Havryliv fest. Vulgäre Ausdrücke, die im slawischen Raum völlig selbstverständlich als Pausenfüller verwendet werden, hört man auch in Wien immer öfter. Wörtlich ins Deutsche übersetzt klingen sie nach sexuellen Perversionen, in den slawischen Sprachen sind sie aber vollständig bedeutungsentleert und mit den Ausrufen „Scheiße!“ oder „Verdammt“ gleichzustellen.
Eine wichtige Beobachtung, die Havryliv sowohl während der Corona-Pandemie als auch nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine beobachtet hat: In Krisenzeiten aktiviert die Sprache ihre kreativen Potenzen, was sich unter anderem in bildhaften Wortkreuzungen äußert. So entstanden während der Corona-Pandemie Wortkreationen wie „Covidiot“ (Covid und Idiot),„Alleinachten“ (Allein und Weihnachten) oder „Coronials“ (Corona und Millennials). „Während wir im realen Leben auf Distanz gingen, verschmolzen die Wörter“, erläutert die Sprachwissenschaftlerin fasziniert diese kompensatorische Funktion. Schimpfwörter dienen hier vor allem der Solidarisierung.
Wie stark die Funktion des Widerstands von Beschimpfungen sein kann, zeigte sich beim Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine am 24. Februar 2022. Als ein russisches Kriegsschiff sich der Schlangeninsel im Schwarzen Meer nähert und die ukrainischen Soldaten zur Kapitulation auffordert, antwortet der ukrainische Soldat Roman Hrybow über Funk auf Russisch sinngemäß „Russisches Kriegsschiff, fick dich!“. Der Spruch ging viral, wurde auf T-Shirts und Werbeplakaten gedruckt und wurde zum Sinnbild des Widerstandes. Im April desselben Jahres brachte die ukrainische Post eine Sondermarke mit dem Konterfei heraus.

Sprache lebt und reagiert auf gesellschaftliche Veränderungen sowohl mit neuen Bezeichnungen als auch mit Bedeutungsveränderungen. „Worte mit Kriegsmetaphern, wie ,jemanden mit Fragen bombardieren‘, Das ist Bombe! oder an der ‘kulturellen Front/,Informationsfront‘ kämpfen verlieren plötzlich ihre metaphorische Bedeutung, weil sie zur Zeit in wörtlicher Bedeutung gebraucht werden“, erläutert die Germanistin. Daran sieht man, wie behutsam man mit Sprache umgehen soll.
Die Bezeichnung „Ukraine-Krieg“ findet sie unmöglich. „In dieser Bezeichnung wird das Aggressor-Land zur Gänze ausgeblendet“, sagt sie. Im Zusammenhang mit Auswirkungen des Krieges auf das alltägliche Leben im deutschsprachigen Raum wie Teuerungen werde das Bild weiter verstellt. Denn damit würden diese Probleme unbewusst mit der Ukraine in Verbindung gebracht und nicht mit Russland. „Wir sollten die korrekte Bezeichnung ‚russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine‘ oder wenn schon kurz ‚Russlandkrieg‘ verwenden“, fordert sie. Damit werde das Aggressor-Land in den Mittelpunkt gestellt.
„Wir sollten den Begriff ,Ukraine-Krieg‘ nicht verwenden.“
Havryliv nimmt an, dass in diesem Kontext auch Umfragen bezüglich des Krieges andere Ergebnisse zeigen würden. Sie nennt ein Beispiel: Bei der Unique-Research-Umfrage im Februar 2022 beantworteten 65 Prozent der befragten Österreicher:innen die Frage „Sollte die Ukraine weiterkämpfen?“ mit „Nein“. Wäre durch korrekte Bezeichnung das Aggressor-Land in den Mittelpunkt gestellt und das Bewusstsein für unterschiedliche Kriegstypen (den Angriffskrieg und den Verteidigungskrieg) gestärkt, wäre die korrekte Frage „Sollte Russland den Krieg beenden und alle besetzten Gebiete verlassen?“
Bei Einladungen zu Interviews betonte die ukrainische Wissenschaftlerin gerade im ersten Jahr des Krieges, wie sehr es ihre Landsleute schätzten, in Österreich so willkommen aufgenommen und unterstützt zu werden. Auch auf akademischem Niveau erzählt sie von Unterstützung und Solidarität wie den speziellen Programmen für ukrainische Wissenschaftler:innen von ÖAD, ÖAW und FWF. Sie selbst hat zum Beispiel im Rahmen der Kinderuni mit Hilfe dieser Institutionen ukrainische Wissenschaftler:innen vermittelt, die Lehrveranstaltungen für ukrainische Kinder halten konnten. Sie hat viele Stipendiat:innen aus den Unterstützungsprogrammen kennengelernt und weiß um die enorme Dankbarkeit der jungen Ukrainer:innen.
Oksana Havryliv leistete Pionierarbeit, als sie 2006 mit einer FWF-Förderung begann, das alltägliche Schimpfen in Wien zu erforschen. Die aus der Ukraine stammende Germanistin untersucht, wie und wann wir schimpfen, welche Funktionen verbale Aggression erfüllt, wie sich diese über Generationen in einer multikulturellen Gesellschaft verändert und wo die Schnittpunkte zur verbalen Gewalt liegen. Sie ist Autorin von über 90 sprachwissenschaftlichen Publikationen (darunter drei Monographien und ein „Deutsch-Ukrainisches Schimpfwörterbuch“). Zuletzt erschien ihr populärwissenschaftliches Buch „Nur ein Depp würde dieses Buch nicht kaufen“, in dem sie die Ergebnisse ihrer langjährigen Forschungsarbeiten zusammenfasst.
Das Buch „Nur ein Depp würde dieses Buch nicht kaufen“ von Oksana Haryliv hält auf amüsante Art alles fest, was man über das Schimpfen wissen muss.