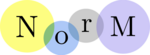Die gute Mutter – ein unerreichbares Ideal

„Die berufstätige Mutter bleibt eine Art Schreckgespenst“, erklärt die Soziologin Ulrike Zartler, die mit ihren Kolleginnen Eva-Maria Schmidt und Fabienne Décieux von der Universität Wien untersucht hat, welche Anforderungen an „gute Mütter“ heutzutage gestellt werden. In Wertestudien vermutet immer noch die Hälfte der Österreicher:innen, dass Kinder leiden, wenn die Mutter berufstätig ist. Und zwei Drittel stimmen zu, dass es nachteilig für das Familienleben ist, wenn die Frau Vollzeit arbeitet. Obwohl Karenzregelungen formal genderneutral formuliert sind, bleiben hierzulande nach wie vor zumeist Mütter lange zu Hause, um sich um Kinder und Care-Tätigkeiten zu kümmern. In das Berufsleben kehren sie anschließend in Teilzeit zurück.
In dem Forschungsprojekt „NorM – Normen rund um Mutterschaft“, gefördert vom Wissenschaftsfonds FWF, erforschten die drei Soziologinnen, welche sozialen Regeln ein anderes Vorgehen möglicherweise behindern. Bisher haben weder neoliberale gesellschaftliche Anforderungen noch Ideen von „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ sichtlichen Einfluss auf die Erwartungshaltungen über Mutterschaft gezeigt.
Das Projekt
Ein Wiener Forschungsteam fragte in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen nach, welche Leitbilder einer „guten Mutter“ in Österreich vorherrschen. Dabei gingen sie auch der Frage nach, wie sich bei Müttern konformes und abweichendes Verhalten im Alltag zeigt und wie sich das auf die Gesellschaft auswirkt.
Einheitliches Mutterbild
Beim Thema Mutterschaft reden alle mit: jene, die eine Mutter haben, selbst Mutter sind oder eine Mutter kennen. Wie denken die Menschen über das Muttersein? Welche Meinungen und Haltungen vertreten sie? Was zeichnet eine gute Mutter aus? Darüber haben die Wissenschaftlerinnen in 24 Online-Gruppendiskussionen mit 173 Frauen und Männern aus ganz Österreich diskutiert. Neben dem Austausch in der Gruppe führten die Wissenschaftlerinnen auch Einzelinterviews mit Müttern von mindestens einem Kleinkind. Diese Analysen wurden durch eine Auswertung der thematischen Fachliteratur ergänzt.
Ein theoretisch fundiertes Sample wurde aus Teilnehmenden in Wien, Tirol, Kärnten und dem Burgenland ausgewählt. In geschlechtsgemischten, aber auch reinen Frauen- und Männergruppen erhoben die Forschenden, welche Leitbilder zur Mutterschaft existieren, wie diese entstehen und gerechtfertigt werden. Zunächst teilten die Gruppen eigene Erfahrungen und Vorstellungen, dann wurden diese anhand von zwei konkreten Beispielen diskutiert.
In diesen beiden Varianten wurde die Karenzzeit beschrieben und 60 Stunden Wochenerwerbsarbeitszeit in einer Familie mit zwei Kindern aufgeteilt. In einem Fall war die Mutter zwei Jahre in Karenz gewesen, mit 10 Stunden wieder eingestiegen, letztlich 20 Stunden erwerbstätig und der Vater durchgehend 40 Stunden. Im anderen Fall war die Mutter vier Monate nach der Geburt wieder Vollzeit eingestiegen, der Vater zu Hause geblieben und beide waren danach je 30 Stunden erwerbstätig. „Überraschend war für uns, wie wenig Unterschiede es zwischen den Gruppen gab. Ob in der Stadt oder am Land, ob ohne Matura oder mit Hochschulabschluss: Wie eine Mutter ist und sein soll, darüber herrscht relative Einigkeit in Österreich“, erläutert Fabienne Décieux.
Permanente Emotionsarbeit
Eine „gute“ Mutter erfüllt in Österreich ein ganzes Bündel an Erwartungen. Sie ist verantwortlich dafür, dass ihr Kind optimale Fürsorge bekommt. Sie ist kindzentriert und kümmert sich als primäre Bezugsperson intensiv und liebevoll um ihr Kind, ist ihm sorgend zugewandt und verbringt möglichst viel Zeit mit ihm. Wenn Mütter von diesen Erwartungen abweichen, entwickelten die Beteiligten in den Diskussionen unterschiedliche Strategien, um deren Verhalten zu entschuldigen, zu dulden oder zu kritisieren.
„Die Kritik wurde nicht unbedingt ausgesprochen, sondern war eher zwischen den Zeilen herauszulesen“, ergänzt Eva-Maria Schmidt. Es fielen Aussagen wie diese: Mütter würden in Österreich „gezwungen, arbeiten zu gehen“, das Muttersein stehe im Kontrast zum Erwerbsleben. Wenn sie das Kind während ihrer Erwerbsarbeitsstunden vermissen, ernten Mütter Verständnis. Eine karriereorientierte Mutter wird zwar geduldet, für die eigene Familie konnte sich das aber kaum jemand vorstellen. Explizite Ablehnung gibt es für „ignorante Mütter“, die ihre eigenen Bedürfnisse über jene des Kindes stellen.
Nur eine glückliche Mutter ist eine gute Mutter
Die 23 Einzelinterviews zeigen, dass Mütter die geltenden Normen eher nicht hinterfragen, sondern Strategien entwickelten, um sie in ihr alltägliches Handeln zu integrieren. Die Vorstellung, dass nur eine glückliche Mutter eine gute Mutter sein kann, ändert nichts an der Erwartung, dass Mütter erst durch eine „Kindzentrierung“ Glück empfinden würden und ihre eigenen Bedürfnisse jenen des Kindes unterordnen sollten. „Die Mütter betreiben akzeptierte Formen der Selbstsorge“, erklärt Fabienne Décieux. Sie nehmen sich Zeit „für die Reproduktion des fürsorglichen Selbst, um wieder gut für das Kind da zu sein“, kümmern sich um die eigene Existenzsicherung durch Erwerbsarbeit.
Sie kontrollieren aber auch ihre Emotionen und passen sie an, um Mutterschaft möglichst positiv und (nach außen) glücklich zu leben. Diese Erwartungen werden auf Social Media zusätzlich idealisiert (Stichwort Tradwives). Um entspannt, zufrieden und glücklich zu sein, tun die Mütter viel. Sie leisten Emotionsarbeit, regulieren beispielsweise Aggression, Frust oder Schuldgefühle, weil sie davon ausgehen, dass ihre positiven Gefühle für die Entwicklung des Kindes wichtig sind.
Erziehung unter Druck
Die empirischen Ergebnisse passen zu jenen in der wissenschaftlichen Literatur für westlich-demokratische, reiche Industrienationen. Beschrieben werden darin die präsente, die öffentliche, die erwerbstätige, die glückliche und die zukunftsgerichtete Mutter. Letztere tut alles für die erfolgreiche Entwicklung ihres Kindes. Wenn sich der Nachwuchs schlecht benimmt, fettleibig ist oder Drogen nimmt, fühlt sie sich dafür verantwortlich und wird auch von der Gesellschaft dafür verantwortlich gemacht. Wenig verwunderlich, dass ein schlechtes Gewissen mit dem Muttersein eng verbunden wird.
Schuldgefühle sind im Spannungsverhältnis multipler Normen eigentlich unvermeidbar. „Wir haben uns bemüht, aus den Diskussionen normative gesellschaftliche Erwartungen herauszuschälen, die ja nicht (mehr) alle ausgesprochen werden. Sie begleiten Mütter das ganze Leben in den Interaktionen mit vielen verschiedenen Menschen“, betont Eva-Maria Schmidt. Ein paar explizite Zitate hat sie dennoch in petto: Gute Mütter „sollen sich aufopfern“, „ihr ganzes Leben zurückschrauben“ und „Verzicht ist selbstverständlich, damit das funktioniert“.
Viele Paare nehmen sich vor der Geburt vor, sich an Sorge- und Erwerbsarbeit gleich zu beteiligen. Andere meinen, das würde sich von selbst ergeben. „Es ist nicht die individuelle Mutter, die es nicht schafft. Viele Menschen stimmen zu, dass Gleichberechtigung gut für die Gesellschaft ist. Aber um das im Familienalltag umsetzen zu können, muss sich viel an den Rahmenbedingungen ändern“, betont Ulrike Zartler. Einig sind sich die drei Soziologinnen darin, dass nicht der Muttertag, sondern die 364 anderen Tage im Jahr das Mutterbild prägen. Und nicht nur Familienmitglieder, sondern viele unterschiedliche Akteur:innen dazu beitragen.
Projektleitung
Ulrike Zartler ist Professorin für Familiensoziologie am Institut für Soziologie der Universität Wien. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Familien-, Kindheits- und Jugendsoziologie, Normen rund um Eltern und Familien, Übergangsprozesse in Familien und im Lebensverlauf, Trennung/Scheidung und deren Folgen sowie die soziologische Analyse des Familien- und Kindschaftsrechts. Ulrike Zartler ist Mitglied des Österreichischen Kinderrechte-Boards und Mitherausgeberin des Journal of Family Research sowie der Interdisziplinären Zeitschrift für Familienrecht. Das Projekt „NorM – Normen rund um Mutterschaft“ wurde vom Wissenschaftsfonds FWF mit 300.000 Euro gefördert.
Publikationen
Schmidt E.-M., Décieux F., Zartler U.: Mothers and Others: How Collective Strategies Reproduce Social Norms Around Motherhood, in: Journal of Family Issues 2024
Décieux F., Schmidt E.-M., Zartler U.: Selbstsorge als Selbstzweck? Bedeutung und Formen von Selbstsorge in Diskursen über gute Mutterschaft, in: Österreichische Zeitschrift für Soziologie 2024
Schmidt E.-M., Décieux F., Zartler U., Schnor C.: What makes a good mother? Two decades of research reflecting social norms of motherhood, in: Journal of Family Theory & Review 2023