Coronavirus: Vom Molekül zum Medikament
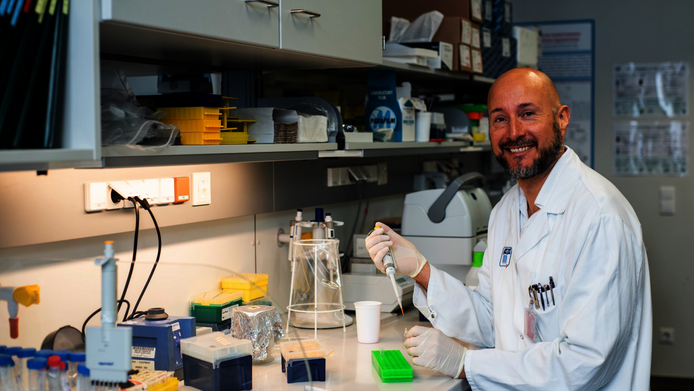
Er ist zurzeit einer der gefragtesten Interviewpartner wenn es um das Coronavirus geht: Der Virologe der Medizinischen Universität Wien Christoph Steininger. Angesichts der Verunsicherung, die überall spürbar ist, sieht er sich und seine Kolleginnen und Kollegen klar in der Verantwortung, den Medien Rede und Antwort zu stehen, um Unsicherheiten und offenen Fragen mit Fakten zu begegnen.
Viren: Komplexes Forschungsfeld
Jene Fakten und Erkenntnisse, deren Basis die jahrelange Grundlagenforschung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den Labors bildet. Es ist ein langer und mitunter steiniger Weg von der Erforschung einer Fragestellung bis zu einem nachweisbaren „Wert“ für die Gesellschaft - wie einem Medikament. „Wir verstehen noch immer nicht ganz, was Viren ausmacht und welche Mechanismen zum Ausbruch einer Krankheit führen“, sagt Steininger. So blieben manche Ausbrüche gar unbemerkt. Als Beispiel nennt der Spezialist für Interne Medizin das Zika-Virus, das 2015 in Lateinamerika ausgebrochen und zu schweren Schädigungen bei ungeborenen Kindern geführt hat. „Vermutlich war es bereits ein Jahr davor unbemerkt in Brasilien angekommen. Wir kennen das Virus, aber niemand hätte in dieser geografischen Region damit gerechnet“, erinnert er sich.
Forschung unter Hochdruck
Mit COVID-19 brach in China – wie schon vor rund zehn Jahren mit SARS – ein neuartiges Virus aus. Das Genom konnte von den chinesischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern rasch entschlüsselt werden. Zurzeit arbeiten weltweit Dutzende Forschungsteams an der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Virus, das sich global ausbreitet. Wann es wirksame Therapien und eine Schutzimpfung geben wird, ist noch schwer abzuschätzen, aber man kann sagen, dass es diesmal deutlich schneller gehen wird als unter gewöhnlichen Umständen.
„Das Coronavirus ist bisher nicht mutiert.“
„Geschwindigkeit beispiellos“
Das lassen auch Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahren des letzten EU-Calls zur Corona-Forschung vermuten. Normalerweise haben die Forschenden mehrere Monate Zeit sich zu bewerben, diesmal waren es lediglich zehn Tage. Dennoch haben sich 91 Forschungskonsortien beworben. Der Virologe ist zuversichtlich, dass es in den nächsten Monaten eine Impfung geben wird. So hätten bereits zwei Forschungsgruppen – aus Australien und den USA – einen Impfstoff in Händen, der gerade evaluiert wird. „Die Geschwindigkeit ist beispiellos“, sagt der Experte.
Gute Nachricht: Coronavirus bisher nicht mutiert
Die Gründe dafür sieht er nicht nur in der Bündelung vieler Ressourcen in die aktuelle Fragestellung, sondern auch in dem Umstand, dass sich das Coronavirus – entgegen aller Befürchtungen – seit seinem Ausbruch Ende Dezember 2019 in der chinesischen Millionenstadt Wuhan nicht verändert hat. Das ist eine gute Nachricht, denn es bedeutet, dass jemand, der einmal an dem Coronavirus erkrankt war, immun gegen den Erreger ist und sich kein zweites Mal infizieren kann. „Wenn einmal ein kritischer Wert an immunen Menschen erreicht ist, kann das Virus sich nicht mehr vermehren“, sagt Steininger. Das unterscheidet Corona auch vom Grippevirus, das sich jährlich verändert. Deshalb hält der Mediziner es auch für unwahrscheinlich, dass sich das Coronavirus etablieren und jährlich zur Grippesaison wieder auftauchen wird.
Impfstoff gegen HIV in Evaluierung
Wie man am Beispiel anderer Erkrankungen sehen kann, dauert es oft viele Jahre bis zur Entwicklung eines wirksamen Impfstoffs. So wurde 1986 das HIV-Virus als Auslöser für die Immunschwächekrankheit AIDS identifiziert und noch heute gibt es keine wirksame Impfung gegen den Erreger. Das liegt laut Steininger hauptsächlich daran, dass HIV rasch in den Patientinnen und Patienten mutiert und es schwierig ist, einen Impfstoff zu entwickeln, der gegen alle unterschiedlichen Varianten wirkt. Zurzeit sei allerdings ein vielversprechendes Produkt in Evaluierung.

Problem CMV-Virus
Im Rahmen eines vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Forschungsprojektes untersucht Steininger das sogenannte Cytomegalivirus, kurz CMV genannt, die häufigste Ursache für angeborene Fehlbildungen. Infektionen mit dem CMV-Virus während der Schwangerschaft führen zu gravierenden Schäden bei Ungeborenen – von Hördefiziten über neurologische Komplikationen wie Gehirnentzündungen bis hin zu Fehlgeburten. CMV stellt auch ein großes Problem für immungeschwächte Patientinnen und Patienten nach Organ- oder Knochenmarkstransplantationen dar und ist die häufigste Ursache für infektionsbedingte schwere Komplikationen.
Wissenschaftlicher Durchbruch
Vor kurzem gelang der Forschungsgruppe um Steininger hier ein bedeutender Durchbruch: Man wusste schon länger, dass der Vitamin-D-Stoffwechsel wichtig für die Erhaltung transplantierter Organe ist. Nun konnten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aber auch nachweisen, dass CMV den Vitamin-D-Stoffwechsel nach unten reguliert. Ein Umstand mit weitreichenden Folgen für Patientinnen und Patienten nach Organ- und Knochenmarkstransplantationen, der bis zum Absterben des Organs führen kann.
Wissenschaft und Medizin
Die Entschlüsselung dieses Mechanismus ist einer jener Erfolgsmomente, die der gebürtige Oberösterreicher als Maturant wohl vor Augen hat, als er sich für ein Studium der Humanmedizin entscheidet. Medizin, erzählt Steininger, vereine für ihn den Kontakt zu Menschen, der ihm sehr wichtig ist, mit der Möglichkeit, wissenschaftlich aktiv zu sein. „Ich kenne wenige Berufsfelder, wo diese Aufgaben so gut vereinbar sind“, sagt der Mediziner und Wissenschaftler aus Leidenschaft. Es sei natürlich eine große Herausforderung, auf zwei großen Gebieten zu arbeiten, „aber genau diese Herausforderung liebe ich“, schwärmt er.
„Das Schrödinger-Stipendium war ein Meilenstein in meiner wissenschaftlichen Karriere.“
Meilenstein Schrödinger-Stipendium
Nach seinem Medizinstudium an der Universität Innsbruck , habilitiert sich der heute 46-Jährige an der Medizinischen Universität Wien und verbringt 2008 ein Jahr mit einem vom FWF geförderten Erwin-Schrödinger-Stipendium an der University of California in San Diego. Ein Forschungsaufenthalt, den er als Meilenstein in seiner wissenschaftlichen Karriere bezeichnet. In den vierzehn Monaten gelingt ihm eine entscheidende Entdeckung: Er identifiziert ein Protein, das für den Prozess verantwortlich ist, der chronische Leukämie immer wieder anheizt.
Amerikanischer Spirit
Noch bedeutender als dieser wissenschaftliche Erfolg erscheint Steininger der Einblick in ein anderes Forschungssystem, den er durch seinen Aufenthalt in San Diego gewinnt. „Das Umfeld war enorm motivierend und bereichernd. Man ist gezwungen, die finanziellen Mittel selbst aufzustellen und zu organisieren. Nichts wird als selbstverständlich angesehen“, erinnert er sich. Dieser „Spirit“ helfe ihm bis heute, denn: „Mit dieser Einstellung findet man immer interessante Partner und Investoren, die bereit sind, spannende Projekte gemeinsam umzusetzen.“

Keine „One-Man-Show“
Nach seinem Aufenthalt in den USA schließt der junge Wissenschaftler zunächst seine Facharztausbildung für Interne Medizin in Wien ab. Ein Schritt, den er als erheblichen Sprung bezeichnet: “Vom Assistenz- zum Facharzt, das bedeutet auch ein anderes Umfeld, andere wissenschaftliche Möglichkeiten.“ Die Forschungsgruppe, die er damals aufbaut, ist mittlerweile enorm gewachsen und behandelt zwei Dutzend unterschiedliche vielversprechende Projekte. Möglich ist dieser Spagat zwischen Klinik und Wissenschaft nur durch kompetente und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Ich bin keine 'One-Man-Show'“, stellt Steininger klar.
Ein produktives Umfeld
In seinen momentan laufenden Forschungsprojekten gebe es keines, in dem nicht eine andere Arbeitsgruppe zumindest involviert sei. „Das ist ein riesiges Netzwerk. Wir tauschen uns aus, inspirieren und unterstützen einander“, berichtet Steininger im Labor des Wiener AKH und hält es für enorm wichtig, in ein produktives Umfeld eingebettet zu sein. Er könne daher jeder jungen Kollegin und jedem jungen Kollegen nur empfehlen, in deren Karriereentwicklung nicht nur das Projekt, sondern auch das Arbeitsumfeld im Blick zu haben.
„In Österreich wird Mentoring zu wenig beachtet.“
Mentoring: Win-win-Situation
Besonders wichtig erachtet Steininger auch den Einfluss von Mentorinnen und Mentoren und vermisst hier in Österreich das nötige Bewusstsein. „Einerseits können junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Netzwerken erfahrener Kolleginnen und Kollegen profitieren und andererseits tragen kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen guten Ruf in die Welt hinaus, was wiederum den Mentorinnen und Mentoren hilft“, beschreibt der Experte diese Win-win-Situation und stellt fest: „Das ist in Österreich leider noch nicht angekommen.“ Steininger selbst hatte das Glück, Mentorinnen und Mentoren auf seinem Weg zu haben. So den Virologen Franz Allerberger, mit dem er seine erste wissenschaftliches Publikation veröffentlichte. Einer weiteren Mentorin – und dem Zufall – ist es zu verdanken, dass Steininger heute an der Medizinischen Universität Wien tätig ist. Clara Larcher vom Institut für Hygiene der Universität Innsbruck traf bei einem Kongress die Virologin Heidemarie Holzmann, die damals einen Mitarbeiter suchte. So kam Steininger von Innsbruck in die Virologie nach Wien.
Leidenschaft und Offenheit
Und wie sieht er seine Rolle als Mentor? Bei der Auswahl seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaut Steininger weniger auf deren Lebenslauf als mehr auf Begeisterungsfähigkeit und Leidenschaft. „Mir ist wichtig, dass sie für etwas brennen!“ Eine wichtige Eigenschaft sieht der Forscher auch in der Bereitschaft, bei Hindernissen Perspektiven zu wechseln und neue Wege einzuschlagen. „Ich habe aus vielen Projekten gelernt, dass unerwartete Ergebnisse Hinweise darauf sind, dass man etwas Relevantes übersehen hat. Hier braucht es die Offenheit, die positiven Seiten zu sehen und ungewohnte Wege zu gehen.“
„Wir müssen klarer kommunizieren, welche Bedeutung unsere Arbeit für die Gesellschaft hat.“
Wissenschaft und Klinik
Einen typischen Arbeitstag gibt es bei Steininger nicht, denn jeder Tag sieht anders aus: Er bewegt sich zwischen der Betreuung von Patientinnen und Patienten, Besprechungen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von laufenden Projekten, Arbeitstreffen mit Kolleginnen und Kollegen anderer Forschungsgruppen und – zurzeit verstärkt – Interviews mit Medien. „Es sind immer lange aber sehr abwechslungsreiche Tage, die nie langweilig werden“, resümiert Steininger. Die Herausforderung im klinischen Alltag sieht er darin, ein Gespür dafür zu entwickeln, wo Diagnose und Therapie klar sind, und wo es wichtig ist, noch einmal genau nachzufragen, weil es Befunde gibt, die nicht zusammenpassen. Hier gibt es eine starke Parallele in der Grundeinstellung zwischen Wissenschaft und klinischer Arbeit: die Bereitschaft und Offenheit, Informationen, die nicht ins Bild passen, nachzugehen.
Mehr Bewusstsein für die Grundlagenforschung
Was die Bedeutung der Grundlagenforschung anbelangt, würde sich Steininger in Österreich mehr Bewusstsein dafür wünschen, dass sie die Basis für viele Produktentwicklungen bildet. Ohne die schiere Neugierde von Forschenden in der Vergangenheit hätten wir heute beispielsweise keine Batterien und keine Röntgenbestrahlung. In der Bewusstseinsbildung sieht Steininger auch die Forschenden selbst in der Verantwortung: „Auch wir müssen klarer kommunizieren, welche Bedeutung unsere Arbeit für die Gesellschaft hat, warum etwa die Erforschung eines Moleküls wichtig für die Entwicklung eines Medikaments sein kann“, sagt er. Spätestens bei Ausbrüchen neuartiger Viren – wie zurzeit – sollte das deutlich werden.
Zur Person
Der Virologe Christoph Steininger ist assoziierter Professor an der Medizinischen Universität Wien und Facharzt für Innere Medizin am Wiener AKH. Er studierte Humanmedizin an der Universität Innsbruck und habilitierte sich in Interner Medizin an der Medizinischen Universität Wien. Neben zahlreichen Forschungsaufenthalten, u.a. in Thailand, Israel, Peru und Deutschland war er von 2008 bis 2009 mit einem Erwin-Schrödinger-Stipendium des FWF an der University of California in San Diego, USA. Steininger ist Leiter des Institutes für Mikrobiomforschung der Karl Landsteiner Gesellschaft. Neben zahlreichen anderen Auszeichnungen erhielt er 2007 den Young Researcher Award der Europäischen Gesellschaft für klinische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten.





