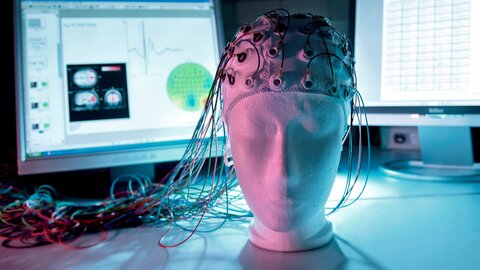Beamtentum: zwischen staatsdienend und staatstragend

Obwohl man es in der österreichischen staatlichen Bürokratie unweigerlich mit Beamten zu tun bekommt, ist die Idee von Staatsangestellten, die im Gegenzug für Dienst und Treue einen sicheren Posten sowie lebenslange Versorgung bekommen, nicht mehr ganz so unausweichlich. Geschichtlich betrachtet ist das Konzept relativ jung. Erst Ende des 18. Jahrhunderts führte Kaiser Joseph II. diese Form des Staatsdienstes mit dem Ideal eines nicht bestechlichen und stets korrekt arbeitenden Diener des Staates ein.
„Das ist immer noch eines der wenigen positiven Stereotype über Beamte“, sagt Therese Garstenauer von der Universität Wien, die sich in ihrem vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projekt einer Forschungslücke annimmt. Man wisse viel über den überbordenden Beamtenstaat der Habsburgermonarchie, reichlich über die Präzision des administrativen Apparates der Nazi-Zeit, aber die Jahre dazwischen hätten bisher nur wenig Beachtung gefunden.
Vom Kaiser zur Krise
Die Beamten waren während der k. u. k. Monarchie und darüber hinaus eine bedeutende Gruppe. Zeitgenössischen Schätzungen zufolge war in den frühen 1920er-Jahren gut ein Siebentel der Bevölkerung vom Staat als Arbeitgeber abhängig, sei es aktiv im Dienst, in Pension oder als Angehörige. „Es kommt nicht von ungefähr, wenn man sagt, dass das Beamtentum Österreich prägt“, äußert sich Garstenauer zu dessen historischen Wurzeln.
Umso einschneidender waren dann die Abbaumaßnahmen, die von 1922 bis 1925 fast ein Drittel der Beamtenstellen wegfallen ließ. Gefordert hatte dies der Völkerbund, als Bedingung für wirtschaftliche Hilfe. „Aber viel eingespart wurde im Nachhinein betrachtet nicht, weil gleichzeitig nicht wirklich viel am System geändert wurde“, so Garstenauer. In Pension geschickte Beamte mussten weiterbezahlt werden und manche Stellen wurden kurze Zeit später wieder nachbesetzt. Gleichzeitig waren Beamte, die ihre Posten behielten, von der Hyperinflation betroffen, die 1922 ihren Höhepunkt erreichte. Ihre fixen Gehälter wurden in kurzer Zeit fast völlig entwertet.

Standesgemäßes Verhalten in harten Zeiten
Therese Garstenauer interessiert sich in ihrer Arbeit insbesondere dafür, wie sich Krisen mit dazugehörigen Abstiegsängsten auswirken. Was passiert, wenn eine solche Gruppe aus dem Mittelstand sich geprellt fühlt, weil die einst als sicher angesehenen Vorstellungen vom Leben nicht eingelöst werden? Eine wesentliche Quelle in dem Projekt sind unter anderem Tausende Akten zu Disziplinarverfahren gegen Beamte aus unterschiedlichsten Bereichen. Auch das Privatleben spielt dabei eine Rolle – dienstrechtlich war festgelegt, dass ein Beamter jederzeit ein „standesgemäßes“ Leben zu führen hat. Damit ist nicht nur ein bestimmter materieller Lebensstandard gemeint, sondern auch, dass ein Beamter sich außerhalb des Dienstes so zu verhalten hat, dass er dem Ansehen des Amtes nicht schadet. Wenn Staatsbedienstete unter Alkoholeinfluss in einem Lokal randalierten, außereheliche Affären hatten oder massiv verschuldet waren, dann wurde das dienstrechtlich zum Problem. In den dokumentierten Verfahren zeigt sich auch die schwierige alltägliche wirtschaftliche Lage in den 1920er-Jahren, selbst bei Beamten mit sicheren Stellen.
So erzählt Garstenauer von einem Postangestellten, der aus einem im Transport beschädigten Paket etwas Hefe zum Brotbacken mit nach Hause nahm, weil viele grundlegende Dinge knapp waren. Ein typisches Vergehen war außerdem, dass Briefe aus dem Ausland geöffnet wurden, in der Hoffnung, darin Fremdwährung zu finden, die der Inflation standhalten würde. Es finden sich aber auch etwas absurdere Geschichten wie der Fall eines Sektionschefs, der eine vom Wind verwehte Pelzmütze gestohlen hatte, nachdem ein Schaufenster im Sturm zerbrochen war.
Manche sind und werden gleicher
Wie die Vergehen geahndet wurden – mit Gehaltskürzungen, Rückstellungen, Kündigungen –, unterschied sich signifikant nach Art des Vergehens und der Person. „Es fällt auf, dass gerade den höheren Beamten sehr wenig passiert, wenn es überhaupt zu einem Verfahren kommt“, erklärt die Historikerin, und meint, dass in solchen Fällen oft eine mildernde Erklärung gefunden und nicht mehr als eine Verwarnung ausgesprochen wurde. Auch enthalten die Akten tendenziell weniger Informationen zum Leben und Hintergrund der Person, wenn der Beschuldigte ein ranghoher Beamter war.
In den 1930er-Jahren mehrten sich dann die Disziplinarverfahren wegen politischer Vergehen. Als Folge des Heimwehrputsches im September 1931 und noch stärker im Ständestaat wurde Beamten untersagt, politisch aktiv zu sein. Und das galt sogar, wenn jemand nur ein Flugblatt in der Tasche hatte oder nichts sagte, wenn ein Kollege im Wirtshaus politisierte. Die Gesellschaft und auch die Beamtenschaft radikalisierten sich im Verlaufe der 1930er-Jahre zunehmend.
Frauen im Dienst des Staates
Es gab auch Frauen, die im öffentlichen Dienst arbeiteten – die längste Zeit eher als Vertragsangestellte denn als krisensichere Beamtinnen. Frauen arbeiteten dabei zum Großteil im niedriger bezahlten Kanzleidienst. Die wenigen, die höhere Positionen erlangten, taten das in den Bereichen Bildung und Soziales. Bis 1919 galt bundesweit ein Beamtinnenzölibat, sodass nur ledige und kinderlose Frauen im Staatsdienst arbeiten konnten. Manche Bundesländer behielten diese Regelung bis in die 1930er-Jahre bei.
Viele traf dann die „Doppelverdienerverordnung“, die in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit dafür gedacht war, möglichst vielen Männern Stellen zu erhalten. Frauen im öffentlichen Dienst, die mit einem Beamten verheiratet waren, mussten ihren Posten verlassen, wenn der Mann eine gewisse Einkommensgrenze erreichte. Ziemlich modern anmutend ist darin ein Hinweis auf nichteheliche Lebensgemeinschaften – wer so versuchte, die Regelung zu umgehen, beging ebenfalls ein Dienstvergehen.
So ungerecht die Verordnung scheint, sie führte zu keinen Massenentlassungen von Lehrerinnen oder Schreibkräften, sondern traf Einzelne in verschiedenen Bereichen. Der angestrebte Nutzen, der Arbeitslosigkeit von Männern entgegenzuwirken, lässt sich daher auch anzweifeln. Was sich allerdings in solchen und anderen Beamtenverordnungen widerspiegelt, sind gesellschaftliche Annahmen dazu, wie ein respektables, standesgemäßes Leben auszusehen hat.
Zur Person
Therese Garstenauer hat Geschichte, Soziologie und Russisch in Wien, Moskau und Edinburgh studiert und an der Universität Wien über Kooperationen zwischen russischen und westlichen Geschlechterforscher:innen promoviert. Beamte als Forschungsgegenstand begegneten ihr erstmals in einem Forschungsprojekt der Österreichischen Historikerkommission zum Vermögensentzug während der NS-Zeit. Nach Mitarbeit in einem Forschungsprojekt zur Unternehmenskommunikation in Russland an der Wirtschaftsuniversität Wien bekam sie das Elise-Richter-Stipendium des Wissenschaftsfonds FWF für ihr Habilitationsprojekt zum Beamtentum der Zwischenkriegszeit (2017–2023) zuerkannt.
Mehr Informationen auf dem Projektblog: Österreichische Staatsbedienstete und standesgemäße Lebensführung