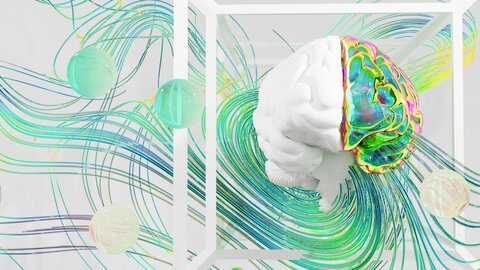Wie Pflanzen ihr Wachstum steuern

Sie untersuchen, wie sich Pflanzen an ihre Umwelt anpassen. Können Sie das Forschungsfeld kurz skizzieren?
Jiří Friml: Pflanzen haben kein Nervensystem, um damit Informationen zu verarbeiten. Sie können auch nicht wie Tiere oder Menschen auf ihr Umfeld reagieren und kämpfen oder davonlaufen. Sie passen ihr Wachstum, ihre Entwicklung an, um den Erfordernissen ihrer Umgebung gerecht zu werden. Bei anhaltendem Wind wird der Stamm eines Baums stärker. An schattigen Plätzen wachsen Pflanzen dem Licht entgegen. Sie haben fantastische Mechanismen, um sich anzupassen und zu überleben. Damit das funktioniert, müssen sie relevante Reize ihrer Umgebung – Licht, Temperatur, Gravitation oder die Verfügbarkeit von Wasser und Nährstoffen – wahrnehmen und in eine Entwicklungsveränderung übersetzen können. Wir haben entdeckt, dass das Pflanzenhormon Auxin durch seinen zielgerichteten Transport zwischen den Zellen das wichtigste und universellste Signal für diese Vermittlungsfunktion ist. Zudem konnten wir in diesem Zusammenhang wesentliche Mechanismen enttarnen, beispielsweise wie Lichtreize das Wachstum der Pflanzen steuern.
Wie sieht diese Vermittlungsrolle von Auxin im Detail aus?
Friml: Auxin ist ein sehr einfacher chemischer Stoff, der von Zelle zu Zelle transportiert wird. Dort nehmen Proteine das Auxin wahr und aktivieren die jeweilige Funktion der Zelle. Die Entstehung jedes Blattes, jeder Blüte und jedes Seitenstängels beginnt mit ein paar wenigen Zellen, in denen sich das Auxin ansammelt. Auf ähnliche Weise wird auch die Ausdehnung des Wurzelsystems gesteuert. Je nach Zelltyp kann das Auxin-Signal Wachstum, die Herausbildung eines neuen Organs oder aber auch einen Wachstumsstopp auslösen.
Welche Methoden nutzen Sie, um Einblicke in die Pflanzenentwicklung zu gewinnen?
Friml: Die Genetik ist ein Hauptwerkzeug. Wir verändern die Gene, die die Proteine in den Pflanzenzellen kodieren. Auf diese Art sehen wir, welches Protein welche Aufgabe erfüllt. Dazu verwenden wir den Modellorganismus der Ackerschmalwand (Arabidopsis thaliana), eine krautige Pflanze, die oft an Ackerrändern zu finden ist. Ihr Genom ist bereits seit Jahrzehnten voll entschlüsselt. Dazu kommen biochemische Methoden, die etwa zeigen, ob ein bestimmtes Protein Auxin bindet oder weitertransportiert. Große Bedeutung haben auch die Entwicklungsbiologie und in letzter Zeit besonders die Bioinformatik. Methoden der künstlichen Intelligenz helfen, Strukturen und Interaktionen von Proteinen vorherzusagen. Auch wenn wir noch weit davon entfernt sind, erarbeiten wir uns langsam die Voraussetzungen für die Modellierung ganzer Pflanzen am Computer.
Zur Person
Jiří Friml leitet die Forschungsgruppe „Pflanzliche Entwicklungs- und Zellbiologie“ am Institute of Science and Technology Austria (ISTA). Der Biochemiker, Zellbiologe und Genetiker studierte in Brünn, Köln und Tübingen. Er hielt Professuren an der Universität Göttingen, am Vlaams Instituut voor Biotechnologie und an der Universiteit Gent, bevor er 2012 ans ISTA wechselte. Zu seinen zahlreichen wissenschaftlichen Auszeichnungen gehören zwei ERC Advanced Grants, die er 2017 und 2024 erhielt. 2015 wurde er mit dem Erwin-Schrödinger-Preis der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ausgezeichnet. Aktuell leitet Friml das FWF-Projekt „Guanylatcyclasen-Aktivität der Auxinrezeptoren TIR1/AFBs“.
„Das Potenzial ist enorm.“
Können Ihre Erkenntnisse in der landwirtschaftlichen Praxis Anwendung finden?
Friml: Das Potenzial ist enorm. Auf einem Weizenfeld fließt viel der Energie der einzelnen Pflanzen in den Konkurrenzkampf um Licht und Nährstoffe. In der Natur ist das eine notwendige Überlebensstrategie, am Feld aber kontraproduktiv. Wenn wir diesen Mechanismus, der vom Auxin vermittelt wird, ausschalten können, lässt sich die Energie in das Wachstum der Weizenkörner umleiten. Das würde den Ertrag eines Feldes geschätzt um bis zu 25 Prozent steigern – ein enormer Zuwachs. Genauso könnte man bei trockenen Böden die Pflanzen tiefer wurzeln lassen, um Wasser zu erreichen. Es gibt unzählige Beispiele dieser Art.
Welche offenen Forschungsfragen möchten Sie in Zukunft beantworten?
Friml: Ich bin sehr daran interessiert, wie sich das Auxin-System evolutionär entwickelt hat. Das Molekül scheint anfangs ein unerwünschtes Stoffwechselprodukt gewesen zu sein, das in zu hoher Dosis toxisch wirkte. Wie es daraufhin zum wichtigsten Signalstoff überhaupt werden konnte, ist eine faszinierende Frage. Ein weiterer Fokus liegt auf den genauen Abläufen innerhalb der Pflanzenzelle. Wir wollen verstehen, was nach der Wahrnehmung des Auxins in der Zelle genau passiert und wie ein und dasselbe Signal in den verschiedenen Zellen so unterschiedliche Auswirkungen haben kann.
Zum Projekt
Die von Jiří Friml geleitete Forschungsgruppe ist auf die Erforschung des Auxin-Signalwegs in Pflanzen spezialisiert. Die pflanzeneigenen Verbindungen regulieren Wachstum und Umweltanpassung der Pflanzen, indem sie auf äußerliche Reize wie Licht oder Temperatur reagieren. Friml und Kolleg:innen kombinieren Methoden aus Zell- und Entwicklungsbiologie, Genetik, Biochemie und Bioinformatik, um Auxin-Transport, Zellpolarität und weitere Mechanismen des Signalweges zu erklären.
„Es ist naheliegend, dass das Auxin einen Signalmechanismus nutzt, der auch von Tieren und uns Menschen bekannt ist.“
Welche Bedeutung hat der Wittgenstein-Preis für Ihre Forschungen?
Friml: Braucht man Geld für die Grundlagenforschung, darf man einerseits nicht zu langweilig sein. Andererseits darf man, überspitzt gesagt, aber auch nicht zu revolutionär sein, denn dann werden die Forschungen als zu risikoreich eingeschätzt. Mit der Freiheit, die uns der Wittgenstein-Preis gibt, können wir nun auch Ansätze ausprobieren, die in den Ohren von Kolleg:innen vielleicht ein bisschen verrückt klingen. Ein Beispiel: Ein von uns entdecktes Phänomen legt nahe, dass das Auxin einen Signalmechanismus nutzt, der seit Langem auch von Tieren bekannt ist – und den auch wir Menschen nutzen, um zu sehen oder auf Adrenalin zu reagieren. Bisher gingen Wissenschaftler:innen mit großer Überzeugung davon aus, dass dieser Mechanismus in den Pflanzen nicht existiert. Unsere Ergebnisse deuten aber darauf hin, dass wesentliche Elemente bisher ignoriert wurden. Das ist also ein sehr kontroverses Thema.
Wodurch beziehen Sie Ihre Motivation im Forschungsalltag?
Friml: Die Frage, wie Pflanzen wachsen und sich an die Umwelt anpassen können, fasziniert mich seit Beginn meiner Karriere. Als Professor hat man viele administrative Pflichten, die auch eher uninteressant sein können. Dazu ist es frustrierend, wenn ein Forschungsansatz nicht aufgeht. Aber immer wieder kommt auch ein Teammitglied mit einem neuen, erstaunlichen oder unerwarteten Ergebnis zu mir. Das sind dann Momente, die mich motivieren. Es macht mir riesengroßen Spaß herauszufinden, wie die Pflanzen funktionieren.