Was liegt wirklich in der Wiener Luft?

Stefan Schreier steht 130 Meter über Wien vor einem Abgrund. Er sieht nach einem Gerät in einem Edelstahlgehäuse mit einem in den Himmel gerichteten Objektiv, das auf der höchsten Plattform des Arsenalturms montiert ist. Von dort läuft ein Glasfaserkabel in einen kleinen Wartungsraum, wo ein Spektrometer und ein Laptop stehen. Das wissenschaftliche Instrument misst seit 2018 Schadstoffe in der Luft über Wien, insbesondere Stickstoffdioxid, das als Verbrennungsrückstand von Dieselmotoren in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist. Gemeinsam mit zwei baugleichen Geräten, die auf Gebäuden der Universität für Bodenkultur und der Universität für Veterinärmedizin angebracht sind, wachen sie über die Wiener Innenstadt und messen die Luftqualität in Bereichen, die bisher einer wissenschaftlichen Untersuchung nicht zugänglich waren.
Messgerät für Streulicht
Luftgütemessungen finden normalerweise in Bodennähe statt. Die Stadt Wien verfügt über ein Netz von 17 über die Stadt verteilten Messstationen. Diese führen Punktmessungen durch, doch die Verteilung der Schadstoffe über der Stadt lässt sich damit nicht feststellen. Der Umweltphysiker Stefan Schreier und sein Team von der Universität für Bodenkultur in Wien wollen diese Lücke nun im Rahmen eines vom Wissenschaftsfonds FWF finanzierten Projekts schließen. Sie verwenden dabei ein Messgerät, das sich „MAX-DOAS“ nennt, kurz für „Multi AXiale Differenzielle Optische Absorptions-Spektroskopie“. Spektroskope wie die drei Wiener MAX-DOAS-Geräte messen charakteristische Abweichungen in der Farbzusammensetzung des Lichts. Das Know-how dazu stammt aus Bremen, wo Schreier dissertierte, und dessen Institut für Umweltphysik ein Projektpartner ist. Der Clou dabei: „Wir können damit erstmals direkt die vertikale Verteilung von Stickstoffdioxid über dem Stadtgebiet von Wien messen“, erklärt der Forscher.
3D-Bild der Schadstoffverteilung
Abhängig von den Wetterbedingungen und der Menge an Aerosolen in der Luft, können die drei Instrumente mehrere Kilometer weit blicken. Dabei überlappen sich ihre Messbereiche, was besondere Möglichkeiten bietet, wie Schreier erklärt: „Wir versuchen, aus den vielen horizontalen Messungen der drei MAX-DOAS-Geräte die räumliche Verteilung von Stickstoffdioxid abzuleiten.“ Das lasse sich mit Computertomografie vergleichen. Dieses dreidimensionale Bild der Verteilung von Stickstoffdioxid über Wien ist das Kernziel des Projekts. Messungen aus 2019 konnten zum Beispiel zeigen, wie an einem Tag mit Ostwind die mit Schadstoffen belastete Luft von den stark befahrenen Straßen und Industriegebieten im Südosten der Stadt nach Westen transportiert wird.
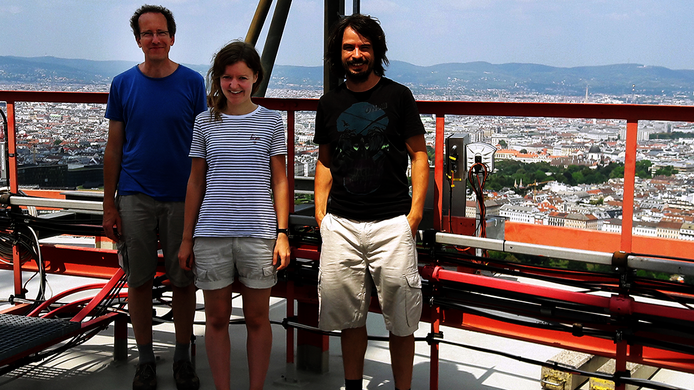
Ergänzung für Satellitenmessungen
Das große Ziel ist aber ein anderes: Es gibt eine weitere Quelle an Informationen zur Stickstoffdioxid-Verteilung in der Atmosphäre. Die ESA betreibt einen Satelliten, der Stickstoffdioxid in der Erdatmosphäre vom All aus misst. „Das erste derartige Instrument wurde 1995 ins All gebracht“, berichtet Projektleiter Schreier und erklärt: „Es hatte eine räumliche Auflösung von mehr als hundert mal hundert Kilometer pro Pixel. Seit 2017 misst das Spektrometer Tropomi an Bord des europäischen Satelliten Sentinel-5p. Dessen Daten liefern ein globales Bild der Stickstoffdioxidverteilung mit einer horizontalen Auflösung von sieben mal drei Kilometer, das sind ein paar Pixel über der Stadt.“ Die Satellitenmessungen sollen wichtige Informationen über gesundheitsschädliche Luftschadstoffe liefern. Allerdings sei nicht klar, wie viel diese Messungen über die Luftgüte knapp über dem Boden aussagen – also dort, wo Menschen leben. Die von Schreier und seinem Team installierten MAX-DOAS-Instrumente sollen helfen, die ESA-Daten zu validieren. „Satellitenmessgeräte lassen sich nicht reparieren, falls ihre Verlässlichkeit nachlässt“, erklärt Schreier. „Es ist deshalb wichtig, die Ergebnisse mit Messungen auf der Erde vergleichen zu können, um sie gegebenenfalls korrigieren zu können.“ Bei Satellitenmessungen wisse man außerdem nicht, in welcher Höhe sich das Stickstoffdioxid befindet.
Messen für die ESA
Das Interesse der ESA an dem Thema ist groß, weshalb für 2016 eine Kampagne zum Vergleich verschiedener DOAS-Geräte ausgeschrieben wurde. Auch Schreiers Team nahm daran teil: „Unser erstes Gerät wurde nach dessen Bau in Bremen getestet. Unmittelbar danach fand eine Messkampagne der ESA in Holland statt, wo MAX-DOAS-Geräte von verschiedenen Forschungsgruppen teilgenommen haben.“ Schreiers Messgerät hat hier gut abgeschnitten, wie aus einer soeben publizierten Arbeit hervorgeht. Nach der Kampagne wurde das Gerät Ende 2016 in Wien installiert und misst seither. Wenige Monate später kam auch das zweite MAX-DOAS-Gerät in die österreichische Bundeshauptstadt. „Im Laufe des Projekts bin ich auf die Idee gekommen, dass ein drittes Gerät im Süden interessant wäre“, sagt Schreier. 2018 habe man dann ein weiteres Messgerät von der Universität Bremen auf dem 155 Meter hohen Arsenalturm im 3. Bezirk installiert.
Beobachtung anderer Schadstoffe
Der Fokus von Schreiers Team liegt derzeit auf Stickstoffdioxid. Das hat auch praktische Gründe, wie der Forscher erklärt: „Stickstoffdioxid ist das Spurengas, das mit der DOAS-Methode am besten nachzuweisen ist.“ Als Nächstes sollen aber auch andere Luftschadstoffe aus den Wiener MAX-DOAS-Messungen abgeleitet werden, etwa auch Feinstaub. „Wir messen außerdem Gase, die für die Bildung von bodennahem Ozon verantwortlich sind, das für unsere Gesundheit sehr schädlich ist“, so Schreier. Daran wird gerade gearbeitet. Das auf fünf Jahre angelegte Projekt läuft noch bis 2021.
Zur Person Stefan Schreier ist Umweltphysiker an der Universität für Bodenkultur in Wien. Er interessiert sich für boden- und satellitenbasierte Fernerkundung von Spurengasen und Aerosolen in der Atmosphäre, insbesondere für die Absorptionsspektroskopie mit Hauptaugenmerk auf die chemische Zusammensetzung der Troposphäre.
Publikationen





