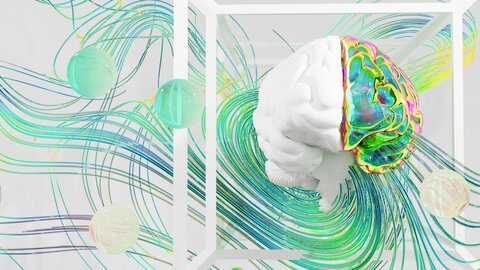Haben die Wiener Orchester tatsächlich einen eigenen Sound? Das Projekt „Signature Sound Vienna“ (2021-2024) hat moderne Analysetools für die gesammelten Aufnahmen der Neujahrskonzerte entwickelt.
Walzerhimmel unter der Lupe

Wenn die Wiener Philharmoniker beim Neujahrskonzert „An der schönen blauen Donau“ von Johann Strauss Sohn anstimmen, ist das für viele Menschen ein Gänsehautmoment. Nach Ausflügen in seltener gespieltes Repertoire kehrt das Orchester in seinem jährlichen Konzertritual immer wieder zu den großen Dauerbrennern zurück: dem Donauwalzer, dem Radetzkymarsch (Johann Strauss Vater), dem Kaiserwalzer (ebenfalls Sohn) und vielen weiteren Fixpunkten. Diese Wiederkehr macht auch einen charakteristischen Wiener Stil für das Publikum einprägsam. Greifbar wird dieser für viele etwa durch den behutsamen und spannungsreichen Aufbau des Donauwalzers mit den charakteristischen Verzögerungen und markanten Tempiwechseln, die die Melodie zum schwungvollen Walzertraum machen.
Das Konzert der Wiener Philharmoniker am Neujahrstag fand erstmals 1941 statt. In den mehr als acht Jahrzehnten seiner Existenz ist eine Vielzahl von Interpretationen zustande gekommen. Man kann die Konzertaufnahmen als eine Daten-Zeitreihe betrachten, die über den Wandel eines Wiener musikalischen Stils Aufschluss gibt. Wie haben sich die Charakteristika des Klangs der Wiener Philharmoniker entwickelt? Welche neuen Aspekte haben verschiedene Dirigenten eingebracht? Das vom Wissenschaftsfonds FWF unterstützte Projekt „Signature Sound Vienna“ soll helfen, diese und viele andere Fragen einer musikwissenschaftlichen Interpretationsforschung einfacher zu beantworten. Der Musikinformatiker David M. Weigl und die Musikwissenschaftlerin Chanda VanderHart von der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw) entwickeln darin mit Kolleg:innen ein Set von Werkzeugen, die einen großen musikalischen Korpus besser vergleichbar machen. Gleichzeitig bauen sie eine Datenbank zu Aufnahmen des Neujahrskonzerts auf, die als erstes großes Anwendungsgebiet der Entwicklung dient.
Schwieriger Überblick
„Selbst für Musiker:innen und Musikforschende mit sehr gutem musikalischen Gedächtnis ist es eine enorme Herausforderung, eine große Zahl von Interpretationen genau im Kopf zu behalten“, veranschaulicht VanderHart die Problematik. „Man versucht sich eine Passage zu merken und sucht das Pendant in der zu vergleichenden Aufnahme – bis man es gefunden hat, sind die Töne im Gedächtnis aber schon wieder verblasst.“ Eine zielführende Hilfestellung muss es also einerseits erlauben, mit der Partitur zu interagieren und gewünschte Stellen auszuwählen, andererseits den Überblick über viele Audioaufnahmen bieten, die den ausgewählten Passagen entsprechen.
Diesen Anforderungen entsprechen zwei Softwareprogramme, die im Rahmen des Projekts entwickelt und weiterentwickelt werden. „mei-friend“, realisiert von Weigl gemeinsam mit dem Programmierer und Musikforscher Werner Goebl, macht Partituren maschinenlesbar. „Das Programm nutzt das Format MEI der Music Encoding Initiative – eine Open-Source-Bewegung zur Codierung von Musik, die sich auch für Nutzer:innen in der Wissenschaftscommunity gut eignet“, erklärt Weigl. Der Computer „versteht“ mit der Codierung also die Struktur der Musik und kann sie in einfacher Intonierung auch wiedergeben. Hier kann man nach interessanten Passagen suchen, sie markieren und Annotationen ergänzen. Diese Ergänzungen kann man als Webstandard-konforme (Linked Data) Datenstrukturen teilen und für andere Programme und Nutzer:innen verfügbar machen.

Systematisches Vergleichen
Die geteilten Daten können dann in ein weiteres Programm mit Namen „Listen Here!“ integriert werden, das dem Vergleichshören der Interpretationen dient. Hier wählt man aus der Datenbank jene Versionen, die man hören möchte. Die importierten Markierungen aus „mei-friend“ führen Nutzer:innen dann direkt zu den gewünschten Stellen, die in den Audiodateien automatisch erkannt werden. „Man kann also einzelne Notenfolgen oder Motive von Dutzenden Interpretationen beliebig schnell hintereinander anhören und im Detail vergleichen“, resümiert Weigl. Mit den frei zugänglichen Programmen können somit nicht nur einzelne Aspekte genau untersucht, sondern auch große Musiksammlungen auf bestimmte Fragestellungen abgeklopft werden.
Im Rahmen des Projekts wurden die Partituren von zehn Stücken, die Fixpunkte beim jährlichen Neujahrskonzert sind, als maschinenlesbare MEI-Dateien codiert. Die entsprechende Datenbank mit den Interpretationen besteht aus Aufnahmen, die am Markt erhältlich sind. „Leider haben die Wiener Philharmoniker ihr Notenarchiv nicht für wissenschaftliche Zwecke freigegeben“, bedauert VanderHart. „Sehr hilfreich war allerdings die Österreichische Mediathek, wo viele Kontextinformationen zu den Aufführungen auffindbar sind.“
Stilistischer Wandel
Die Geschichte der Neujahrskonzerte ist von zwei Langzeitdirigenten – Clemens Krauss und Willi Boskovsky – geprägt, bevor sich ab den 1980ern Lorin Maazel, Herbert von Karajan, Claudio Abbado, Carlos Kleiber und viele weitere Koryphäen abwechselten. Sie alle greifen frühere Interpretationen auf, versuchen der Musik aber auch eigene Nuancen mitzugeben. Für Chanda VanderHart zeigt die von den neuen technischen Mitteln ermöglichte Analyse, wie unterschiedlich die Dirigenten – alle waren bisher Männer – an die Musik herangehen. „Ein Thema im Kaiserwalzer mit einem martialischen Grundton klingt in den frühen Aufnahmen etwa noch recht militärisch, bevor es sich in späteren Jahren stilistisch vollkommen wandelt, harmloser, runder wird und plötzlich beinahe ein bisschen an Karussell-Musik erinnert“, gibt die Musikwissenschaftlerin ein anschauliches Beispiel.
Spannend ist etwa auch, wie sich beim Flötenspiel des Donauwalzers eine Aufführungspraxis weitgehend durchgesetzt hat, die von allen wissenschaftlichen und üblichen Partituren abweicht. Auch die charakteristischen Pausen und Tempiwechsel in den Wiener Interpretationen des Stücks scheinen über die Jahre immer stärker ausgebaut zu werden. „Über die Zeit betrachtet lässt sich sagen, dass sich die Walzer des Neujahrskonzerts immer weiter von einer ursprünglichen Spielweise als Tanzmusik wegbewegen“, resümiert VanderHart. „Sie werden symphonischer, formal offener und kontrastreicher.“
Zu den Personen
David M. Weigl forscht an der Schnittstelle von Computer- und Kulturwissenschaften. Frühere Stationen seiner Karriere waren die University of Edinburgh, die McGill University und die Oxford University. 2018 wechselte er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an das Institut für musikalische Akustik – Wiener Klangstil der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw).
Die Musikwissenschaftlerin, Pianistin und Musikvermittlerin Chanda VanderHart studierte in New York, Mailand und Wien und ist seit 2016 an der mdw. Als Pianistin gastierte sie in zahlreichen Konzerthäusern weltweit. Gleichzeitig spielte sie eine Reihe von Musikalben ein, darunter Werke von Brahms, Schumann und Copland.
Das Projekt „Signature Sound Vienna“ wird vom Wissenschaftsfonds FWF mit 406.000 Euro gefördert und schließt im Sommer 2024 ab.
Publikationen
Weigl D. M., VanderHart Ch. et al.: Listen Here! A Web-native digital musicology environment for machine-assisted close listening, in: Proceedings of the 10th Int. Conference on Digital Libraries for Musicology (DLfM '23) 2023
VanderHart Ch., Nurmikko-Fuller T., Weigl D. M.: Hand in Hand: Strauss’ Kaiserwalzer as a case study of interdisciplinary collaboration in digital musicology, in: Digital Humanities 2023 Book of Abstracts, Grazdavi, Austria
Weigl D. M., VanderHart Ch., Goebl W: Let’s be mei-friends! Musikcodierung leicht gemacht, in: Methoden und Ziele der digitalen Musikwissenschaft (GfM Tagung 2023, Saarbrücken)
Weigl D. M., VanderHart Ch. et al.: The Vienna Philharmonic Orchestra’s New Year’s Concerts: Building a FAIR Data Corpus for Musicology, in: Proceedings of the 9th Int. Conf. on Digital Libraries for Musicology (DLfM ’22) 2022