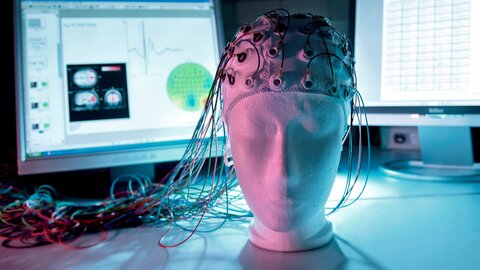Stammbaumforschung für den Artenschutz

„Falls die Haie aussterben, bricht die gesamte Nahrungskette zusammen.“ So warnt Jürgen Kriwet, Professor am Institut für Paläontologie der Universität Wien. Gemeinsam mit seinem Team möchte er mit dem vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Forschungsprojekt „Evolution und Aussterberisiko von Haien und Rochen“ den Stammbaum der Haie und der verwandten Rochen – der letzten Vertreter der lebenden Knorpelfische – genauer als je zuvor aufzeichnen. „Wir wollen herausfinden, wieso diese Tiere evolutionär so erfolgreich sind. Das kann uns auch dabei helfen, auf heutige Schutzmaßnahmen besser zu fokussieren“, sagt der Wissenschaftler.
Seit über 200 Millionen Jahren bilden Haie die Spitze der marinen Nahrungskette. Damit tragen sie wesentlich zum Erhalt des ökologischen Gleichgewichts bei. „Ohne Haie würden sich die Tiere, von denen sie sich ernähren, enorm vermehren und dadurch wiederum ihre eigene Nahrungsgrundlage überstrapazieren“, sagt Kriwet. „Das hat einen fatalen Kaskadeneffekt auf die gesamte Nahrungskette bis hinunter zu den Algen und Einzellern.“ Aus diesem Grund plädiert der Forscher für einen gezielteren Schutz von Haien, der ihre lange und komplexe Evolutionsgeschichte miteinbezieht.
„Haiarten, die es schon länger gibt, sind widerstandsfähiger als kurzlebige Arten“, erklärt Kriwet. „Die Langlebigen konnten sich besser an die sich ändernden Umweltbedingungen anpassen. Wir glauben, dass ihnen das auch bei der Bewältigung heutiger, menschgemachter Veränderungen wie dem Klimawandel und Überfischung helfen wird.“
Doch dazu müssen die Forschenden den Stammbaum der Haie genauer verstehen, um nachzuvollziehen, welche Arten verwandt sind und wie lange diese existierten – und das ist leichter gesagt als getan.
Zur Person
Jürgen Kriwet forscht am Institut für Paläontologie der Universität Wien. Mit dem Projekt Evolution und Aussterberisiko von Haien und Rochen liefert er die wissenschaftlichen Grundlagen für einen verbesserten Artenschutz.
Unklare Verwandtschaftsverhältnisse
Das Problem liegt in der Komplexität der Evolution und in lückenhaften Daten. Um Lücken zu schließen, vergleichen Wissenschaftler:innen die körperlichen Eigenschaften von Fossilien und gegenwärtigen Lebewesen. So können sie Rückschlüsse darauf ziehen, welche Tiere über die lange Geschichte hinweg verwandt sind, denn viele Eigenschaften werden von einer Art an die aus ihr entstehenden Arten weitergegeben. Zusammen mit geologischen Informationen über das Alter der Gesteinsschicht, in denen die Fossilien gefunden wurden, ergibt sich damit ein evolutionärer Stammbaum.
Die Schwierigkeit dabei ist, dass zu wenige Fossilien verfügbar sind und dass sich ähnliche körperliche Eigenschaften in verschiedenen Arten entwickeln können, die nicht nahe verwandt sind. Dieses Phänomen wird als konvergente Evolution bezeichnet. Zum Beispiel haben Delfine und Haie beide stromlinienförmige Körper, um durch das Wasser zu gleiten, doch sie sind nicht eng verwandt.
Erst Anfang der 1980er-Jahre wurde der genetische Fingerabdruck entwickelt. Mit der DNA-Sequenzierung können Forschende die Erbinformationen verschiedener Lebewesen vergleichen und damit auch auf deren Verwandtschaftsverhältnisse schließen. Je näher zwei Lebewesen verwandt sind, desto ähnlicher ist ihr genetischer Code. Aber auch hier gibt es Herausforderungen. Eine Veränderung in den Genen muss nicht immer die Entstehung einer neuen Art bedeuten und DNA von lange ausgestorbenen Arten fehlt.
Hinzu kommt, dass diese verschiedenen Methoden unterschiedliche Stammbäume produzieren, die sich aufgrund neuer Forschung auch immer wieder ändern. „In unserem Projekt möchten wir die verschiedenen Zugänge auf Basis von Vergleichen von Fossilien und lebenden Tieren sowie DNA-Sequenzierung erstmals für eine umfassende Untersuchung von Haien und Rochen zusammenführen“, so Kriwet über den Anspruch des Projekts.

Vielfältige Zähne und Haie im Mittelmeer
Um ihr Ziel zu erreichen, arbeiten Kriwet und die Doktorand:innen Julia Türtscher und Patrick Jambura an einer Vielzahl verschiedener Herangehensweisen. Sie analysierten die Zähne und Kieferformen gegenwärtiger und fossiler Haiarten, um auf deren Entstehungsgeschichte zurückzuschließen. Bei diesen Tieren spielen Zähne eine besondere Rolle, denn sie wachsen ständig nach. Dadurch sind sie oft als Fossilien zu finden, während die Knorpel-Skelette der Haie und Rochen in der Regel nicht erhalten bleiben. Die Form der Zähne und Kiefer passte sich den Umweltbedingungen und Nahrungsformen im Lauf der Evolution immer wieder an, was den Forschenden dabei hilft, Arten zu unterscheiden.
Sie fanden dadurch einen ausgestorbenen Verwandten des Weißen Haies, dessen Zähne und Kiefer zeigen, dass er harte Nahrung wie Schalentiere fraß. „Das zeigt, dass diese Gruppe rund um den Weißen Hai früher viel diverser war“, fügt Kriwet hinzu. „Wir konnten auch zeigen, wie die Vorfahren des Weißen Haies über die Zeit größer und größer wurden.“
Der Doktorand Patrick Jambura nutzte neue phylogenetische Methoden unter Einbeziehung molekulargenetischer Informationen, um die verschiedenen Stammbäume zusammenzuführen, die sich aus Fossilienvergleichen und DNA-Sequenzierung ergeben. Damit ergeben sich neue Stammbäume, die sowohl die Verwandtschaftsverhältnisse als auch die zeitliche Abfolge von Haiarten besser als je zuvor beschreiben.
Mithilfe von Bürger:innen bringt Überraschung
Ein besonderer Aspekt dieser Forschung ist die Zusammenarbeit mit Nichtwissenschaftler:innen im Rahmen von Citizen-Science-Projekten, die von Sichtungen von Haien und Rochen berichten. „Wir arbeiten hier insbesondere mit Kolleginnen und Kollegen in Kroatien und auch in Libyen zusammen, um einen besseren Einblick in die tatsächliche Artenvielfalt im Mittelmeer zu erhalten“, sagt Kriwet. „So haben wir beispielsweise erfahren, dass der Weiße Hai vor der Küste Libyens in den letzten Jahren mehrfach gesichtet wurde. Man hatte zuvor angenommen, dass es ihn im Mittelmeer gar nicht gibt.“
Mit einer Vielzahl an Methoden, Partnern und auch wissenschaftlichen Publikationen war das Forschungsprojekt sehr erfolgreich. „Wir sind sehr froh, dass dieses sehr ambitionierte Projekt in der Grundlagenforschung finanziert wurde“, freut sich Kriwet. „Daraus sind schon mehrere Folgeprojekte entstanden und wir arbeiten auch mit dem WWF zusammen, um den Schutz der Haie auf Basis unserer Erkenntnisse zu verbessern.“
Zur Person
Jürgen Kriwets Leidenschaft für Haie begann schon im Kindesalter. Er studierte später Geologie und Paläontologie an der Freien Universität Berlin, promovierte an der Humboldt-Universität Berlin und hat seit 2010 eine Professur für Paläobiologie am Institut für Paläontologie der Universität Wien inne. Mit dem vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Forschungsprojekt Evolution und Aussterberisiko von Haien und Rochen (2020–2025) liefert er die wissenschaftlichen Grundlagen für einen verbesserten Artenschutz.
Publikationen
López-Romero F.A., Stumpf S., Kamminga P. et al.: Shark mandible evolution reveals patterns of trophic and habitat-mediated diversification, in: Communications Biology 2023
Villalobos-Segura E., Marramà G., Carnevale G. et al.: The Phylogeny of rays and skates (Chondrichthyes: Elasmobranchii) based on morphological characters revisited, in: Diversity, 2022
Türtscher J., López-Romero F.A., Jambura P.L. et al.: Evolution, diversity and disparity of the tiger shark lineage Galeocerdo in deep time, in Paleobiology 2021