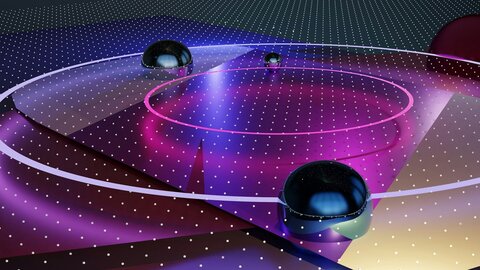Robuste Netzwerke bis ins hohe Alter

Allein zu leben hat viele Vorteile. Im fortgeschrittenen Alter ist dies jedoch oft keine bewusste Wahl. Durch den Tod der Partnerin oder des Partners müssen viele in diese neue Situation erst hineinwachsen. Im Jahr 2018 waren laut Statistik Austria 51 Prozent der Haushalte von Menschen über 65 Jahren Ein-Personen-Haushalte – Tendenz steigend. Je älter, desto größer wird der Frauenanteil: Während 59 Prozent der Frauen über 80 Jahren allein leben, sind es bei den Männern nur 24 Prozent. Jenseits der statistischen Zahlen wirft diese Entwicklung etliche Fragen auf. Ist es für Menschen in Ein-Personen-Haushalten machbar, bis zuletzt daheim zu bleiben? Wie sind Hilfe- und Pflegebedürftigkeit zu bewältigen? „Wir sollten gängige Bilder aufbrechen, etwa dass das höhere Alter gleichzusetzen ist mit Pflegebedürftigkeit oder dass alleinlebende Menschen automatisch einsam sind. Hinter ‚alleinlebend‘ verbirgt sich nämlich eine Vielzahl an Beziehungskonstellationen, wie wir in unserem Forschungsprojekt feststellen konnten“, erklärt Sabine Pleschberger, Leiterin der Abteilung Gesundheitsberufe der Gesundheit Österreich GmbH. Wie vielfältig sich das Leben für Alleinlebende im fortgeschrittenen Alter in Bezug auf Beziehungen und sogenannte „Unterstützungsnetzwerke“ gestaltet, ergründet die Pflege- und Gesundheitswissenschaftlerin in einem aktuellen Forschungsprojekt, das vom Wissenschaftsfonds FWF gefördert wird. Kooperationspartner sind das Forschungsinstitut für Altersökonomie der Wirtschaftsuniversität Wien und das Institut für Pflegewissenschaft der Universität Wien. Die Rolle von Freunden, Bekannten oder Nachbarn steht dabei im Zentrum des Forschungsinteresses.
Zielgruppe nur über Vertrauensaufbau erreichbar
Über die Lebenssituation von in Österreich (hoch-)betagten Alleinlebenden mit Hilfe- bzw. Pflegebedarf ist wenig bekannt. Denn über schriftliche Befragungen ist diese Zielgruppe schwer erreichbar. Daher sind sowohl hochaltrige Menschen als auch Alleinlebende mit Hilfebedarf unter ihnen in quantitativen Studien unterrepräsentiert. „In unserer qualitativen Längsschnittstudie beträgt der Altersdurchschnitt in der Stichprobe 84 Jahre. In diesem Alter beginnen meist Einschränkungen, etwa der Beweglichkeit oder der Mobilität, den Alltag stärker zu beeinflussen. Dann kommt die Frage auf, ob man daheim wohnen bleiben kann“, sagt Pleschberger. Ihrem Team gelang es, für die erste Interviewrunde 23 alleinlebende Frauen und 9 Männer zwischen 67 und 99 Jahren zu gewinnen. Sie leben in ländlichem wie städtischem Umfeld in den Bundesländern Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark und Wien. Zwei Drittel haben keine Familie bzw. keine Familie im Nahbereich: Obwohl die Forschenden ausschließlich nach Letzteren gesucht haben, offenbarten in manchen Fällen erst die Interviews, welche Vielfalt an Beziehungskonstellationen sich dahinter verbergen kann. So können sich etwa Betroffene als alleinlebend oder ohne Familie definieren, selbst wenn es Angehörige zweiten oder dritten Grades gibt, die Familienbeziehungen jedoch von Konflikten überschattet sind. Die Altersgruppe und die Themen Hilfs- und Pflegebedürftigkeit bis hin zum Tod gelten im Forschungskontext zudem als hochsensibel. In punkto Ethik setzen die Forschenden deshalb hohe Maßstäbe. Das Studiendesign wurde vorab von einer Ethikkommission begutachtet, deren „Votum“ oder auch Prüfung, jährlich verlängert werden muss. Für qualitätsvolle Daten braucht es in den Interviews außerdem Zeit, um Vertrauen aufzubauen. „Wir dringen in schambesetzte, tabuisierte, sehr persönliche Bereiche vor. Wer hilft mir, wenn es mir schlechter gehen sollte? Was kann ich als Gegenleistung anbieten? Und was beschäftigt mich mit Blick auf das Lebensende? Über solche Themen wird erst im zweiten oder dritten Gespräch gesprochen“, betont die Forscherin. Zum aktuellen Zeitpunkt sind die Erhebungen abgeschlossen. Aus den Daten der ersten Interviews erarbeitete das Team eine Typologie von Unterstützungsnetzwerken. Wie sich diese im Zusammenhang mit wachsender Hilfe- und Pflegebedürftigkeit verändern, wird Gegenstand der Analyse der Längsschnittdaten sein. Bei der Längsschnittstichprobe stehen die „außerfamiliär informell Helfenden“ im Zentrum, weshalb Betroffene mit familiären Beziehungen nicht mehr dabei sind.
Außerfamiliäre Unterstützung erstmals im Fokus
Freunde, Bekannte sowie Nachbarinnen und Nachbarn bezeichnet die Forschung als „außerfamiliäre informelle Helfende“ (non-kin-carer). Sie haben gemeinsam, dass sie mit den Betroffenen nicht verwandt (non-kin) sind. Bisher wurden sie in der Forschung meist zur Gruppe der „Angehörigen“ gerechnet. Diese „außerfamiliären Unterstützungsarrangements“ sind jedoch unterschiedlich gewachsen und gebaut und erwachsen meist aus dem sozialen Netzwerk einer Person. Aus den Befragungsergebnissen konnten die Forschenden nun vier Netzwerktypen kategorisieren: „non-kin-fokussiert“, „formell-fokussiert“ (z.B. mobile Dienste, Hausarzt, Reinigungskraft), „familienfokussiert“ und „diffus/zerstreut“. Betrachtet man die Verteilung zwischen Männern und Frauen, so fällt auf, dass Frauen in Non-kin-Netzwerken stärker vertreten sind. Die Männer der Stichprobe wiesen eher formell-fokussierte Netzwerke auf, speziell dann, wenn sie bereits hilfe- und pflegebedürftig waren. Was den Familienstand der Alleinlebenden betrifft, waren jene mit non-kin-fokussierten Netzwerken tendenziell nie verheiratet oder seit längerer Zeit verwitwet. „Der Familienstand ‚verwitwet‘ allein sagt wenig über die Lebenssituation aus. Wer zum Beispiel länger verwitwet ist, hatte mehr Zeit, um sich (wieder) ein außerfamiliäres soziales Netz aufzubauen“, erklärt Pleschberger. Wenn dem Tod des Partners oder der Partnerin eine lange Pflegephase voranging, hatten die pflegenden Angehörigen mitunter ein ausgedünntes Netz, weil sie soziale Beziehungen nicht ausreichend pflegen konnten. Denn ebenso, wie sich der Bedarf an Hilfe und Unterstützung langsam wandelt, brauchen soziale Beziehungen Zeit, um sich zu tragfähigen Netzwerken zu entwickeln.
Offenheit, Miteinander und Enttabuisierung
Ein Beispiel: Frau Müller lebt alleine in einer Großstadt und geht mit Freundinnen regelmäßig ins Theater. Was passiert, wenn mit der Zeit ihre Mobilität abnimmt und sie nicht mehr selbstständig außer Haus kann? Überstehen soziale Beziehungen solche Veränderungen und passen sich die Beteiligten den Umständen an? Oder zerbrechen die Beziehungen? Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass viele Faktoren den Charakter von Unterstützungsnetzwerken beeinflussen. So spielen etwa Mobilität (Öffentliche Verkehrsmittel, Auto, Mitfahrgelegenheiten), Distanzen (kurz/lang) in der Wohnumgebung oder auch Persönlichkeitsmerkmale der involvierten Personen (gesellig/introvertiert) eine Rolle. Der Zeitpunkt, zu dem körperliche Pflege notwendig wird, stellt alleinlebende Menschen jedoch vor große Hürden. „Es ist mit viel Scham und Betroffenheit besetzt, wenn die Freundin mitbekommt, dass am WC ein Malheur passiert ist. Hier werden Beziehungsgrenzen überschritten und Neuland betreten“, betont Sabine Pleschberger. Während dies für manche bedeutet, gewisse Aufgaben nicht zu übernehmen, hat dies für andere eine beziehungsfördernde Funktion.
Gegenseitige Bedürfnisse respektieren
Welche Faktoren beeinflussen, ob außerfamiliäre Helferinnen und Helfer Pflegebedürftige weiterhin unterstützen oder gewisse Tätigkeiten an professionelle Dienste abgegeben werden, wollen die Forschenden besser verstehen. Die außerfamiliären, informellen Beziehungen zu erhalten, auch wenn der Unterstützungsbedarf steigt, ist eine zentrale Herausforderung. Denn wie die bisherigen Forschungsergebnisse belegen, sind sie eine wesentliche Ressource, damit alleinlebende ältere Menschen trotz wachsender Hilfe- und Pflegebedürftigkeit zuhause leben können. „Es gilt jedoch, sie in ihrem Charakter, ihrer Unterschiedlichkeit und mitsamt ihren Grenzen zu respektieren. Weder kann damit ‚gerechnet‘ werden, noch sollten die Helfenden überfordert werden“, schließt Pleschberger. Offen ist, wie die alleinlebenden Menschen darin unterstützt werden können, die Optionen mit ihrem sozialen Umfeld auszuloten. Daher werden die Forscherteams die finalen Studienergebnisse mit Expertinnen und Experten aus der Praxis sowie mit Stakeholdern aus dem Bereich der mobilen Pflege und Betreuung diskutieren. Auf diese Weise sollen Wege aufgezeigt werden, wie ein Miteinander von (verlässlicher) formaler Hilfe und außerfamiliären Netzwerken so gestaltbar ist, dass auch alleinlebende Menschen bis zuletzt zuhause wohnen bleiben können.
Zur Person Sabine Pleschberger ist Pflege- und Gesundheitswissenschaftlerin. Sie hat ihre Habilitation an der Universität Klagenfurt erworben und leitet nach mehrjähriger Forschungstätigkeit an Universitäten seit 2018 die Abteilung Gesundheitsberufe der Gesundheit Österreich GmbH. Sie beschäftigt sich mit der Entwicklung von Gesundheitsberufen sowie informeller Pflege und Fragen der Versorgung im Alter sowie Palliative Care. Das FWF-Projekt „Alleinlebende ältere Menschen – Unterstützung durch informelle Helfer am Lebensende“ mit einem Fördervolumen von knapp 390.000 Euro läuft noch bis 2022.
Publikationen