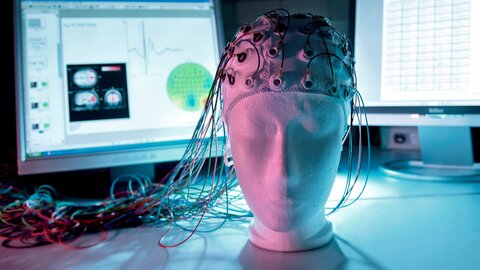Rassenideologie: „absurd und widersprüchlich“

Die Schaufenster der Zuckerbäckerei „Demel“ in der Wiener Innenstadt waren stets ein Hingucker – sogar während des Zweiten Weltkriegs. Bei einem Spaziergang mit ihrer Mutter im Jahr 1942 betrachtete die neunzehnjährige Lotte Freiberger die Kuchen einmal besonders sehnsuchtsvoll. Lotte war laut NS-Kategorisierung das Kind einer sogenannten „nicht-privilegierten Mischehe“, musste wegen ihrer Mitgliedschaft bei der Israelitischen Kultusgemeinde seit September 1941 einen Judenstern tragen und durfte das Geschäft nicht betreten. Ihre „arische“ Mutter, eine Christin, die zum Judentum konvertiert war, zum Schutz der Familie 1938 aber aus der Israelitischen Kultusgemeinde wieder austrat, schon. Ein Gestapo-Beamter in Zivil beobachtete, wie die Mutter ihrer Tochter Lotte ein Stück Kuchen kaufte und es ihr gab. Die Zeitzeugin erinnerte sich im Interview, dass er erbost auf sie zugestürmt kam. Mimi Freiberger hatte in seinen Augen gegen mehrere Gesetze verstoßen. Eines davon betraf das Verbot des freundlichen Umgangs mit Juden. „Er war wie vor den Kopf gestoßen, als er erkannte, dass es sich um Mutter und Tochter handelte“, erzählt Michaela Raggam-Blesch, Historikerin an der Universität Wien. Situationen wie diese waren häufig und verdeutlichen die Widersprüchlichkeit der NS-Ideologie, der zufolge es multikonfessionelle Ehen bzw. „Mischehen“ gar nicht geben sollte. Besonders nach der Deportation eines Großteils der jüdischen Bevölkerung mit Ende 1942 gerieten in Wien Mitglieder dieser vorläufig geschützten Gruppe zunehmend in den Fokus der NS-Behörden. „Die Zahl der antijüdischen Gesetze und Verordnungen stieg an und der Alltag wurde damit zunehmend kriminalisiert. Wurde man bei einer Übertretung erwischt, konnte das ein Todesurteil sein“, erklärt die Forscherin. Lotte Freiberger war etwa der Kauf und Genuss gewisser Lebensmittel wie Fleisch, Eier, Weizenmehl oder Kuchen ebenso verboten wie der Besuch von Parks und Kinos –, die Liste der Verbote war lang.
Akten und persönliche Erinnerung
Insgesamt führte Raggam-Blesch mehr als 30 Interviews mit Zeitzeuginnen und -zeugen für ihr Habilitationsprojekt durch. Der Wissenschaftsfonds FWF förderte das Forschungsprojekt im Rahmen des Elise-Richter-Programms, und der Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus stellte die Kontakte zu den Nachkommen her. Im Mittelpunkt stand die Gruppe der Kinder aus multikonfessionellen Ehen, die entweder als „Mischlinge“ oder „Geltungsjuden“ kategorisiert wurden, aber auch ihre jüdischen und christlichen oder konfessionslosen Elternteile. Dabei interessierten die Forscherin insbesondere folgende Fragen: Welche Faktoren waren für den Schutz von Angehörigen aus „Mischehefamilien“ entscheidend? Und: Wie wirkte sich die Fremdzuschreibung „halbjüdisch“ auf die Identität der Kinder aus? „Lange galten sie als Personen, denen im Vergleich zur restlichen jüdischen Bevölkerung quasi ‚nichts passiert‘ ist, weil der Großteil nicht deportiert wurde. Viele betrachteten sich bis in die 1990er-Jahre selbst nicht als Verfolgte. Ihre Erfahrungen hatten folglich keinen Platz und wurden auch von der Geschichtsforschung vernachlässigt“, betont die Historikerin. Erst die Anerkennung durch den Nationalfonds gab vielen das Gefühl, dass ihre Verfolgungserfahrungen offiziell wahrgenommen wurden. Neben den von ihr durchgeführten Interviews zog Raggam-Blesch auch Quellen des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes (DÖW) und der Shoah Foundation heran. Eine weitere wichtige Quelle ist das Archiv der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) in Wien: Mit Ende Oktober 1942 war der Großteil der jüdischen Bevölkerung deportiert und die Kultusgemeinde in den „Ältestenrat der Juden in Wien“ umgewandelt. Dieser war ab jetzt für alle Angehörigen von „Mischehen“ zuständig, die unabhängig von ihrer Konfession als jüdisch galten. Daher existieren in diesem Archiv ab 1943 reichlich Berichte und Akten über „Mischehefamilien“, etwa zu Fürsorge oder Wohnungsvergabe. Was die Täterseite betrifft, sind die Gestapo-Tagesberichte (DÖW) und die „Mischlingskartei“ am Wiener Stadt- und Landesarchiv von Bedeutung, die verschiedenste Informationen beinhaltet, wie etwa Familienkonstellationen oder Heiratsansuchen. „Personen, die als ‚Mischlinge‘ kategorisiert waren, mussten einen Antrag stellen, wenn sie einen ‚Arier‘ bzw. eine ‚Arierin‘ heiraten wollten, was jedoch so gut wie nie gewährt wurde. Dadurch wurden sie jedoch aktenkundig“, ergänzt die Historikerin.
Zentrale Lebensbereiche betroffen
Kinder und junge Menschen aus „Mischehen“ waren von den restriktiven Heiratsbestimmungen und dem massiven Eingriff in die Schullaufbahn besonders betroffen. In welchem Ausmaß entschied wiederum die NS-Kategorie: Die Mitgliedschaft bei der Israelitischen Kultusgemeinde machte den Unterschied, ob man als „Geltungsjude“ oder „Mischling“ (kein IKG-Mitglied) klassifiziert wurde. Letztere konnten die Kategorie der gesamten Familie auf „privilegierte Mischehe“ heben. Ob die jüdische Religion daheim praktiziert wurde, spielte in der NS-Logik keine Rolle. Je nach Status wurden die Betroffenen dann entweder sofort aus der Schule geworfen („Geltungsjuden“), oder konnten bis zum Verbot im Sommer 1942 noch höhere Schulen besuchen („Mischlinge“). Welche Folgen dies für den Einzelnen haben konnte, verdeutlicht die Zeitzeugin Lotte Freiberger. „Die Vierzehnjährige wurde 1938 vom Gymnasium geworfen. Ihr ‚arischer‘ Freundeskreis wandte sich von ihr ab. Sie belegte dann Kurse an der Israelitischen Kultusgemeinde und lernte Verfolgte aus ähnlichen Familienkonstellationen kennen“, berichtet Raggam-Blesch, „wodurch es zu einer Annäherung an die jüdische Identität kam und diese fortan positiver besetzt war.“ Für viele habe sich die NS-Identitätszuschreibung „halbjüdisch“ aber bis zuletzt als fremdbestimmt angefühlt.
Überlebensstrategien und ungewohnte Allianzen
Ob eine multikonfessionelle Ehe zur Kategorie „privilegiert“ oder „nicht-privilegiert“ zugeordnet wurde, entschied primär das Religionsbekenntnis der Kinder, in kinderlosen „Mischehen“ das Geschlecht des jüdischen Elternteils, doch seien die rassenideologisch geprägten Kategorisierungen absurd und widersprüchlich gewesen, so Raggam-Blesch. Ihre Forschung zeigt nun auf, welche Überlebensstrategien die Betroffenen entwickelten. „Um den Kindern die Diskriminierung zu ersparen, wurden gelegentlich auch Ansuchen auf Anerkennung eines ‚arischen‘, statt des jüdischen Vaters gestellt “, sagt die Forscherin. Oft hing das Überleben der jüdischen Familienangehörigen zudem vom couragierten Verhalten des christlichen oder konfessionslosen Ehepartners bzw. der Ehepartnerin ab, was bis heute mitunter kaum gewürdigt wird. So erinnert sich die Zeitzeugin Vilma Neuwirth, deren Autobiografie veröffentlicht wurde, dass sich ihre christliche Mutter für ihren jüdischen Mann und die Kinder das Parteizeichen auf Nachthemd oder den Mantel heftete, damit sie im Fall einer Kontrolle oder Aushebung durch die Gestapo unter ihren Schutz fallen. Auch die Überwindung von konfessionellen Grenzen sowie selbst die unfreiwillige Annäherung von „Ältestenrat“ und Angehörigen von „Mischehen“ konnte Erleichterung verschaffen. Beispielsweise feierte die „Erzbischöfliche Hilfsstelle für nichtarische Katholiken“ ab 1943 katholische Feiertage und Messen auch in jüdischen Wohlfahrtseinrichtungen, in denen die Mehrheit der Personen Christen waren. Zwar war das Verhältnis ambivalent, „aber die jüdische Gemeinde hat den Kontakt auch geschätzt, weil sie von der ‚Erzbischöflichen Hilfsstelle’ mit dringend benötigten Lebensmitteln, Medikamenten und auch finanziell unterstützt wurde. Diese enge Zusammenarbeit wurde nach 1945 rasch vergessen“, sagt die Forscherin. Die Erfahrung, von heute auf morgen ausgegrenzt zu werden, prägt viele Betroffene bis heute. Die mündlichen Lebenszeugnisse zeichnen zusammen mit der Vielfalt an schriftlichen Quellen nun auch für die Situation in Wien ein detailliertes Bild über die Verfolgungserfahrungen jener, denen damals angeblich „nichts passiert ist“. Die ständige Gratwanderung und die Unsicherheit, wann und ob sich das Blatt wendet, bringen die Forschungen ebenso ans Licht wie persönliches Leid und wo einander trotz Lebensgefahr doch die Hände – oder ein Stück Kuchen – gereicht wurden.
Zur Person Michaela Raggam-Blesch ist Historikerin für jüdische Geschichte und war bis Ende 2017 am Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften tätig. Seit Anfang 2018 forscht und lehrt sie an der Universität Wien. Sie befasst sich u.a. mit autobiografischen Quellen und Frauen- und Geschlechtergeschichte und ist Mitglied der Forschungsgruppe Microcosms of the Holocaust an der Universität Utrecht.
Publikationen