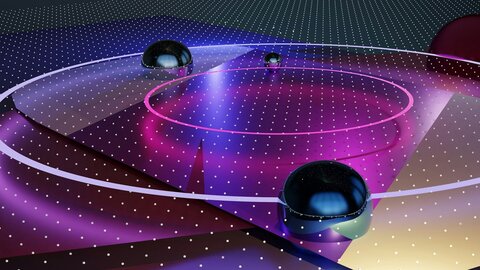Kunstkritik in Zeiten von sozialen Medien

In der Schule hat man mit Kunst hauptsächlich auf zwei Arten zu tun: Entweder man betätigt sich selbst künstlerisch oder man lernt Kunstgeschichte. Doch Bildnerische Erziehung könne viel mehr sein, ist Iris Laner, Professorin für Bildende Kunst und Bildnerische Erziehung am Mozarteum in Salzburg, überzeugt. Das zeigt auch ein Blick in die Geschichte. In der Antike galt ästhetische Bildung noch als Grundlage für ein Verständnis der Welt: Sich gezielt mit Mythen und Kunst als fiktionale Welt auseinanderzusetzen stand notwendigerweise vor der Suche nach der Wahrheit in der echten Welt. Die starke emotionale Kraft der Künste galt vielen auch als Gefahr – Platon war darum Verfechter strikter Zensur.
Besserer Umgang mit sozialen Medien
Statt den Zugang zu Medien einzuschränken, möchte Laner lieber das Potenzial eines verantwortungsvollen und kritischen Umgangs mit der Macht der Bilder ergründen. Bildnerische Erziehung kann mehr als hochhehre Kunstliebe weitergeben, ist die studierte Philosophin überzeugt: „Umfassende ästhetische Bildung kann uns dabei helfen, uns insgesamt besser in der Welt zu orientieren.“
Wenn man lernt, die eigenen Sinneseindrücke wahrzunehmen, einzuordnen und zu verstehen, kann man sich selbst und anderen besser erklären, warum etwas auf einen wirkt und wie man selbst eigentlich mit Bildern umgeht – keine unwesentliche Fähigkeit in der Bilderflut der modernen Welt. Gerade auch, weil es um die subjektive Wahrnehmung geht. Anders als bei thematischen Debatten gibt es keine wirklich richtige oder falsche faktenbasierte Antwort darauf, ob ein Bild schön, bewegend oder eindrucksvoll ist. Man kann dazu selbst eine Meinung finden, aber auch lernen, andere Meinungen nachzuvollziehen.
„Museumisch“ kommt uns nicht ins Haus
In dem vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projekt „Ästhetische Praxis und Kritikfähigkeit: Bildung als Bedingung ästhetischer Erfahrung“ untersucht Projektleiterin Laner, wie 14-Jährige mit unterschiedlichem Bildungshintergrund Bilder analysieren und besprechen, wie sie mit ästhetischen Artefakten umgehen und wie sie sich Meinungen über diese bilden. Dazu sollten die Schüler:innen unter anderem ihre Eindrücke zu drei unterschiedlichen Porträts in Fokusgruppeninterviews besprechen. Es zeigte sich, dass sie dabei gerne bekannte Floskeln, aber auch eigene Wortkreationen verwendeten, um komplexere Konzepte auszudrücken.
Das Wort „museumisch“ zum Beispiel setzte sich durch, um zu beschreiben, warum man
ein bestimmtes Bild eher nicht bei sich zu Hause aufhängen würde: „Für die Jugendlichen war das eher ein Schimpfwort – und bedeutet oft, dass man sich nicht mehr weiter damit auseinandersetzt. Das gehört ins Museum, nicht in meine Welt, und ist damit nicht interessant für mich“, erklärt Laner die vorläufigen Ergebnisse des Grundlagenprojektes, das noch bis Ende des Jahres läuft.
Sprache prägt die vorherrschende Meinung
Die Sprache der Jugendlichen war richtungsweisend. Kam ein Begriff auf, wurde er meist weiter übernommen. Die Diskussion kreiste oft lange um ein Thema, das zu Beginn angeschnitten wurde – etwa ob die dargestellte Person weiblich oder männlich ist –, das Gespräch folgte dann diesen Bahnen. Sprachliche Äußerungen lenkten die Aufmerksamkeit und Bewertung in der Diskussion, aber ein Eindruck oder Gefühl lässt sich nicht immer leicht in Wörter übersetzen. Sprache ist daher auch nicht der einzige Ausdruck, den die Schüler:innen verwendeten, um ihre Meinung preiszugeben.
Vieles, was gegen die vorherrschende Meinung ging, wurde eher über Körpersprache bemerkbar, fand Laner heraus. In Beobachtungsprotokollen hielten sie und ihr Team solche Momente fest; zum Beispiel, als sich ein Mädchen von der Gruppe wegdrehte und dann zu sich murmelte, dass nicht alle den dargestellten „Gangster“ so cool fänden.
Ergebnisse in den Unterricht bringen
„Es ist leichter für Schülerinnen und Schüler, abweichende Meinungen nichtsprachlich auszudrücken – es ist eine andere Ebene und bricht damit auch eingespielte Reaktionsmuster auf“, betont Laner. Man könnte also im Unterricht beginnen, unterschiedliche Ausdrucksformen zu fördern: Fachsprache, Alltagssprache, aber auch Bilder und Gesten zulassen und als gleichwertig etablieren, um auf die Eindrücke von Bildern zu reagieren.
Wie das in der Praxis funktionieren könnte, will Laner in einem Folgeprojekt untersuchen. Dabei geht es nicht nur darum, Kritikfähigkeit zu schärfen, sondern auch um die Bereitschaft, sich zum Nachdenken und Nachfühlen anregen zu lassen: „Wenn Kunst etwas beitragen kann, dann ist es, Denkräume und Fühlräume zu schaffen. Das sollte allen Kindern und Erwachsenen zur Verfügung stehen“, sagt die Philosophin und Kunstpädagogin. Noch empfinden viele junge Menschen aber die Schwelle zwischen Kunst und Alltagskultur als hoch.
Zur Person
Iris Laner studierte Philosophie und Bildnerische Erziehung an der Universität Wien und promovierte an der Universität Basel über „Bild und Zeit“. Sie absolvierte Forschungsaufenthalte an der Universität St. Gallen, der KU Leuven, der Universität Tübingen und an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Seit 2019 ist sie Professorin für Kunstpädagogik am Mozarteum in Salzburg. Das Projekt „Ästhetische Praxis und Kritikfähigkeit“ (2017–2022) wird vom Wissenschaftsfonds FWF mit rund 229.000 Euro gefördert.
Publikationen
Iris Laner: Ästhetik, in: Milena Feldmann, Markus Rieger-Ladich, Carlotta Voß, Kai Wortmann (Hg.): Schlüsselbegriffe der Allgemeinen Erziehungswissenschaft. Pädagogisches Vokabular in Bewegung, Beltz Juventa 2022
Iris Laner: Dekonstruktion, in: Emmanuel Alloa, Thiemo Breyer, Emanuele Caminada (Hg.): Handbuch Phänomenologie, Mohr Siebeck 2022
Iris Laner: French Theory: Poststructuralism and Deconstruction, in: Kresimir Purgar (Hg.): The Palgrave Handbook of Image Studies, Palgrave Macmillan 2021
Iris Laner: Sehen in Gemeinschaft. Über Wissen und Erkenntnisse im Zuge gemeinschaftlichen Erfahrens, in: Kunstpädagogische Positionen 54, Hamburg University Press 2021