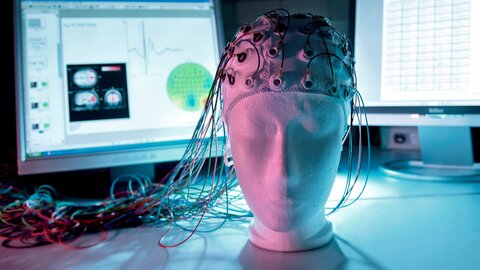Konfliktgeladene Grauzonen der Erinnerung

Die Eröffnung des Museum des Zweiten Weltkriegs im polnischen Gdańsk (Danzig) liegt erst zwei Jahre zurück. Seit vergangenem Jahr wird das moderne Museumskonzept nun auf politischen Druck der rechtspopulistischen Partei PiS hin umgekrempelt. Der politische Grund in Kurzform: zu viel Schande, zu wenig „Wahrheit“. Mit dem ursprünglichen Konzept einer vielfältigen Erinnerungskultur, die auch die Sicht der Zivilbevölkerung auf den Krieg beinhaltete, gingen die Verantwortlichen neue Wege. „Auch Geschlechterverhältnisse, etwa verbotene Beziehungen mit Zwangsarbeitern, oder die polnische Mitverantwortung wurden thematisiert. Das durchbrach die traditionelle Politikgeschichte, vor allem die Heldenerzählung von den Polen als mutigen Widerstandskämpfern, die jetzt wieder in den Vordergrund gerückt werden soll“, erklärt die Politikwissenschafterin Ljiljana Radonić vom Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Deutlich mehr Pathos spürt man indes im Museum des Warschauer Aufstandes in Warschau, das 2004 eröffnet wurde. Letzteres ist eines von zehn post-sozialistischen Gedenkmuseen aus neun jungen EU-Mitgliedsländern Ostmittel- und Südosteuropas, mit denen sich die vom Wissenschaftsfonds FWF geförderte Richter-Stipendiatin im Detail befasste. In ihrem Forschungsprojekt verglich Radonić, wie die Gedenkmuseen den Zweiten Weltkrieg thematisieren und ging etwa auch der Frage nach, weshalb es in Rumänien und Bulgarien keine gibt. Diese Ergebnisse bilden jetzt die Basis für ein vom Europäischen Forschungsrat finanziertes fünfjähriges Forschungsvorhaben zur Globalisierung von Erinnerung.

Angleichung versus Wunsch nach Anerkennung
Wie stark sich politische Umwälzungen auf die Erinnerungskultur auswirken, verdeutlicht auch ein Beispiel aus Ungarn. In Budapest liegt die Eröffnung eines neuen Museums, das Haus der Schicksale, das den ungarischen Retterinnen und Rettern der jüdischen Bevölkerung viel Raum gibt, wegen internationalen Widerstands seit 2014 auf Eis. Dessen Konzept wird von Kritikerinnen und Kritikern als geschichtsrevisionistisch betrachtet und als Gegenpol zum Holocaust-Dokumentationszentrum verstanden, das sich auch der ungarischen Mitverantwortung widmet. Die vergleichende Analyse belegt zudem, dass die politische Öffnung nach 1989, besonders aber die EU-Beitrittsbemühungen, das Erinnern an den Zweiten Weltkrieg in den Gedenkmuseen prägten. „Einige blickten stark nach Westen und wollten ihr ‚Europäisch-Sein’ beweisen, was ich als ‚Anrufung Europas’ bezeichne. Diese Orientierung an internationalen Standards drückt sich etwa darin aus, wie – vor allem jüdische – Opfer dargestellt werden“, erklärt Ljiljana Radonić. Nämlich individualisiert und mit Privatfotos und Kurzbiografien versehen. Dies treffe auf das Museum des Slowakischen Nationalaufstandes, das Jasenovac-Gedenkmuseum in Kroatien und das genannte Dokumentationszentrum in Ungarn besonders zu. Parallel dazu gebe es vor allem in den untersuchten drei baltischen Museen und im Haus des Terrors in Budapest die Tendenz, von Europa zu fordern, „die jeweils eigenen, nationalen Leiden unter dem Kommunismus anzuerkennen“.
Inklusion erzeugt nicht Gleichwertigkeit
Die Annahme, dass die Opfer des Zweiten Weltkriegs – unabhängig von ihrer Religions- oder Staatszugehörigkeit – heute weitgehend ähnlich dargestellt werden, ist ein Trugschluss. Wie stark dies, in Einzelfällen sogar an demselben Ort, auseinanderklafft, überraschte selbst die Politologin und nennt ein Beispiel: „Im Museum der Okkupationen und des Freiheitskampfs im litauischen Vilnius werden die litauischen Opfer individualisiert dargestellt. Von jüdischen Opfern sind hingegen nur Fotos einer anonymen Masse, etwa als Deportierte auf einem Waggon zu sehen.“ Obwohl im Gebäude sowohl Sowjets als auch Nationalsozialisten folterten, hat das Museum die NS-Zeit erst nach 2011 erstmals thematisiert. Eine Ursache besteht laut Radonić darin, „dass die Zahl der jüdischen Opfer viel größer war, was die kollektive litauische Opfererzählung bedroht.“ Bei einer anderen Opfergruppe, nämlich den Romnija und Roma, besteht für die Wissenschafterin der Grund, warum diese trotz ausreichend Archivmaterials oft nicht individualisiert dargestellt werden, in unreflektierten eigenen Bildern, Ressentiments und der noch jungen Debatte über deren Inklusion in Museumserzählungen.

Weder zu viel, noch zu wenig Um die Leiden, die einer der wohl schrecklichsten Kriege aller Zeiten hervorrief, nachvollziehbar zu machen, setzen gegenwärtig viele Museen darauf, den Besucherinnen und Besuchern die Opferperspektive – etwa wie sich Deportierte in den Waggons fühlten – erfahrbar zu machen. Die Forscherin begegnet diesem Trend mit Skepsis: „Dass man sich so fühlen soll wie Deportierte, ist manipulativ, nicht einlösbar und daher fragwürdig. Erniedrigende, riesige Abbildungen von Opfern können zudem Befremden und Distanz auslösen, weshalb Emotion nicht per se erstrebenswert ist.“ Gemäß dem Motto „weniger ist mehr“ erzeugt hingegen das Konzept im Ghetto-Museum im tschechischen Terezín (Theresienstadt) Empathie: Hier wird eine Kombination aus Privatfotos, Kurzbiografien und Zeichnungen von Häftlingen gezeigt. Dieser Befund ergab sich aus Radonićs Analyse der Ausstellungsführer der Gedenkstätte Theresienstadt von 1963 bis heute. Ein Mangel an kritischem, gesellschaftspolitischem Diskurs über Erinnerung – so die These – kann sogar dazu führen, dass es, wie in Sofia und Bukarest, gar keine Gedenkmuseen gibt. So kann der Staat die geschichtliche Deutungshoheit weiterhin für sich beanspruchen, heikle Themen wie zivile Opfer oder Mitverantwortung bleiben ausgespart und sind in der öffentlichen Wahrnehmung dadurch kaum existent.
Zur Person Ljiljana Radonić ist Politikwissenschafterin am Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Initialzündung für das FWF-Projekt „Der Zweite Weltkrieg in post-sozialistischen Gedenkmuseen“ war ihre Dissertation über kroatische Vergangenheitspolitik mit Fokus auf das Jasenovac-Gedenkmuseum. Im Vorjahr erhielt Radonić einen Consolidator Grant des Europäischen Forschungsrats (ERC), der es ihr ermöglicht, sich bis 2024 mit der Globalisierung von Erinnerung in 50 Museen auf 4 Kontinenten zu befassen.
Publikationen