Emotionen sind stets Teil der Wahrheit
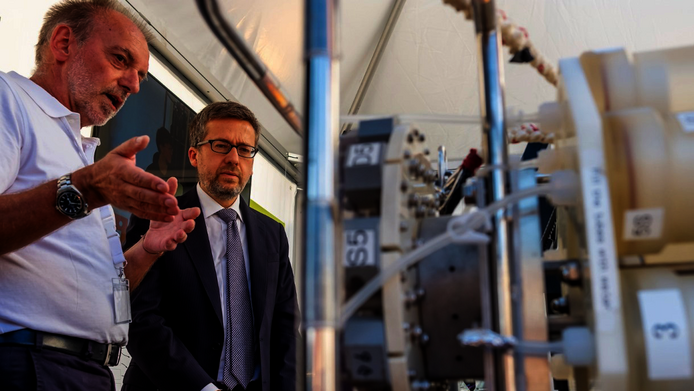
Dass Ärzte ihre Hände gründlich waschen und desinfizieren, ist heute meist eine Selbstverständlichkeit. Die gesundheitlichen Risiken sind bekannt, und die Ansprüche an die medizinischen Alltagspraktiken entsprechend hoch. Doch als das Wissen um die Zusammenhänge von Handhygiene und Krankheiten noch neu war, stieß es auf massiven Widerstand. Die neuen Fakten brachte erstmals der Mediziner Ignaz Philipp Semmelweis auf den Tisch. Seine Studien aus den Jahren 1846/1847 zeigten auf, warum die Sterblichkeitsrate von Müttern an Kindbettfieber in der von Ärzten und Medizinstudenten geführten geburtshilflichen Abteilung am Allgemeinen Krankenhaus in Wien deutlich höher war, als in jener Abteilung, wo Hebammen die Geburten begleiteten. Im Wesentlichen hing dies damit zusammen, dass die Ärzte im Gegensatz zu den Hebammen in der Früh zuerst die Toten obduzierten. Vor einer Geburt wurden die Hände dann nur gewaschen. Doch trotz der eindeutigen Belege, dass Hygienemaßnahmen hochwirksam waren, wurden die Erkenntnisse von führenden Medizinern lange nicht als wahr anerkannt. Der Grund, weshalb Ignaz Semmelweis mit dieser Tatsache scheiterte, sei die emotionale Art und Weise gewesen, wie der Mediziner um Anerkennung seines neuen Wissens bzw. der Fakten kämpfte – so lautet eine oft gehörte Argumentation. Warum diese Erklärung zu kurz greift, hat die Politologin und Firnberg-Stipendiatin Anna Durnová in einem vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projekt untersucht.
Trennung mit Folgen
An dieser wissenschaftlichen Kontroverse war für die Forscherin auffällig, dass das emotionale Verhalten von Semmelweis in den Vordergrund gestellt wird. „Dabei wird ausgeblendet, dass es auf beiden Seiten – bei Semmelweis und seinen Gegnern – emotional wurde“, sagt Durnová, „wobei heute viele dazu neigen, Emotionen als Zeichen von Nicht-Wissenschaftlichkeit zu betrachten.“ Die Tendenz, Wissenschaftlichkeit von Emotionen zu trennen, löst bei der Forscherin Unbehagen aus. Erstmals, als sie beobachtete, dass sich im Zuge der Diskussionen um „Post-Wahrheit“ seit 2016 vielerorts die Wissenschaftsgemeinden auf die Verteidigung der Rationalität einschworen und diese gegen Emotionen in Stellung brachten. Die Großdemonstration „March for Science“ wandte sich gegen eine „postfaktische Ära“ und plädierte etwa mit Blick auf die Klimapolitik von US-Präsident Donald Trump für mehr wissenschaftliche Evidenz in der Politik. Dabei entstand jedoch ein einseitiges Bild von Wahrheit, das die Politologin als „rational, objektiv und in Opposition zu Emotionen beschreibt.“ Gerade die Vernachlässigung und Ausgrenzung von Emotionen überlasse diese ihrer Ansicht nach aber Populisten und Wissenschaftsverweigerern und das „postfaktische Zeitalter“ sei die Folge davon.
Neue Erkenntnisse lösen Emotionen aus
Durnová nimmt die Zusammenhänge zwischen Emotionen und Wissen in ihrer Forschungsarbeit hingegen gezielt in den Blick: „Neu daran ist, dass ich bei Kontroversen die emotionalen Stimmungen benennen und herausfiltern möchte. Auf diese Weise versteht man besser, wieso eine neue Erkenntnis diskutiert wird.“ Dazu analysierte die junge Wissenschafterin im FWF-Projekt die historische Kontroverse rund um die Handhygiene und verschiedene aktuelle Debatten. Dabei stellte sich heraus: Welche Emotionen dabei aus welchem Grund eine Rolle spielen, lässt Rückschlüsse auf gesellschaftspolitische Aspekte, wie etwa Machtinteressen, und auf gesellschaftliche Dynamiken zu. „Die These von Semmelweis und sein neues Wissen waren für viele Ärzte lästig und unangenehm. Aus deren Sicht bedrohte es ihren Status und ihre Reputation. Außerdem hätten sie sich eine Mitverantwortung eingestehen und ihre Alltagspraktiken umkrempeln müssen“, erklärt Durnová. Für die Politologin steht „lästig“ synonym für eine wichtige emotionale Dynamik, die bis zur Delegitimierung einer neuen Erkenntnis als „unwahr oder unseriös“ führen könne. Die Analyse von Diskursen über Emotionen bringt somit ans Licht, was die Basis für eine wichtige Unterscheidung schafft: Wird eine neue Erkenntnis als lästig empfunden, weil sie Machtinteressen oder ein Weltbild bedroht, oder ist sie wissenschaftlich gesehen Unsinn?
Wahrheit wird „verhandelt“
„Mich hat jener Knackpunkt interessiert, wo Neues entdeckt, aber noch nicht allgemein als wahr akzeptiert ist“, ergänzt die Forscherin, die am Institut für Höhere Studien und der Karls-Universität Prag tätig ist. Ihrer Forschungsarbeit legt sie deshalb den Begriff der „Wahrheitsproduktion“ zugrunde. Dieses dynamische Konzept integriert sowohl Akteurinnen und Akteure (d.h. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler), als auch Emotionen und öffnet so den Blick für den Umstand, dass Wahrheit immer auch verhandelt wird. Ihr Ansatz versteht Emotionen als Teil der Wahrheitsproduktion und hinterfragt: Warum und von wem wird was wie bezeichnet? Welche Emotionen beeinflussen die Akzeptanz von Fakten? Wird etwas nicht als wahr akzeptiert, muss der Grund dafür nicht in der vermeintlichen Ablehnung von Fakten oder der Emotionalität von Einzelnen oder Gruppen liegen. „Studien zeigen, dass es nicht darum geht, dass den Gegnern die Fakten unbekannt sind, sondern dass sie sie nicht kennen wollen. Weil es hier um gesellschaftliche Stimmungen geht, kommen wir mit Fact-checking nicht weiter“, gibt die Forscherin im Gespräch mit scilog zu bedenken. Die Teilung einer Gesellschaft in „rational/wissenschaftlich“ versus „unwissenschaftlich/emotional“ birgt für demokratische Systeme die Gefahr, dass Personen oder Gruppen aus dem Diskurs um Wahrheit gedrängt und neue, unbequeme Erkenntnisse zudem leichter als illegitim dargestellt werden können. Zum Kern der Kontroversen vorzudringen und so Fehlentwicklungen argumentativ besser entgegensteuern zu können, wäre nicht nur damals von Vorteil gewesen. Denn Fakten sind eben nur ein Teil des Problems. Emotionen machen es komplett.
Publikationen
Understanding emotions in post-factual politics: negotiating truth. Edward Elgar Publishing, 2019
Understanding Emotions in Policy Studies through Foucault and Deleuze, Politics & Governance, Volume 6, Issue 4, Pages 95-102, 2018
In den Händen der Ärzte. Ignaz Philipp Semmelweis – Pionier der Handhygiene. Wien, Residenzverlag 2015
Zur Person
Anna Durnová erforscht die soziopolitischen Zusammenhänge von Emotionen und Wissen. Derzeit ist sie Fellow am Institut für Höhere Studien Wien und außerdem am Institut für Public and Social Policy der Karls-Universität Prag tätig. Ihr Ansatz, die politischen Aspekte am Fallbeispiel Semmelweis (siehe Publikationen) zu analysieren, stieß international auf großes Interesse und viel Resonanz.





