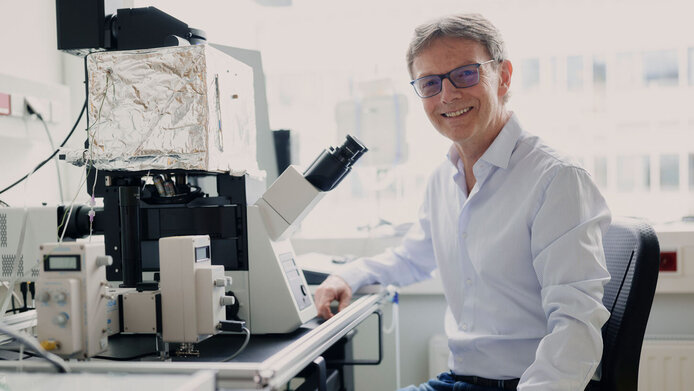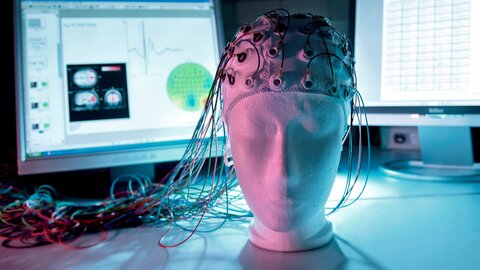„Stress spielt eine wichtige Rolle, sowohl als prädisponierender als auch als Trigger-Faktor“, weiß Singewald. Wobei diese Faktoren nicht direkt die Gene beeinflussen, sondern über epigenetische Marker ihre Aktivität steuern, d. h. wie viel vom jeweiligen Genprodukt (Protein) gebildet wird. Spielen diese Mechanismen zusammen, verstellt sich als Folge im Gehirn das Angstnetzwerk. Die zunächst nützliche Angst wird krankhaft und entsteht auch ohne reale Bedrohung.
Die Angst vor der Angst und 500 Formen
Problematisch ist zudem, dass sich oft eine Angst vor der Angst entwickelt und Betroffene versuchen, bestimmte Situationen zu vermeiden, was ihren Alltag belastet und ihre Lebensqualität beeinträchtigt. Unbehandelt können sich Folgeerkrankungen wie Depressionen oder Alkoholsucht entwickeln.
Die Psychologie unterscheidet 500 Formen von Angst. Es gibt spezifische Ängste, wie jene vor bestimmten Tieren oder vor großer Höhe, und unspezifische Ängste, wie Panikstörungen oder die generalisierte Angststörung (GAS), bei der Betroffene ständig mit einem erhöhten Angstniveau leben und sich permanent um alles Mögliche Sorgen machen. Häufig gehen Angststörungen auch mit anderen psychischen Erkrankungen wie Depressionen einher.
Bewegung erhöht Neuroplastizität
Die gängige Therapie beinhaltet Psychotherapie – vor allem kognitive Verhaltenstherapie und Konfrontationstherapie –, Pharmakotherapie und Bewegung. „Gerade bei Angstpatient:innen wirkt jede Form von Bewegung sehr gut“, sagt der Wissenschaftler, „denn sie regt im Gehirn die Neuroplastizität an.“ Neuroplastizität ist die Fähigkeit des Gehirns, sich kontinuierlich zu verändern, sich an verschiedene Reize anzupassen und regional zu wachsen.