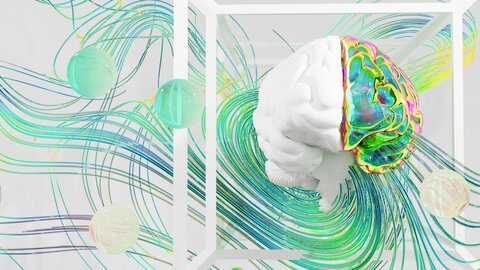Adelige als wirtschaftliche Kraft im Habsburgerreich

„Follow the money“, die Spur des Geldes aufnehmen, lautet ein Grundsatz solider Recherchearbeit. Veronika Hyden-Hanscho vom Institute for Habsburg and Balkan Studies der Österreichischen Akademie der Wissenschaften beleuchtet in ihrem vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projekt „Einkommen, Management und ökonomisches Denken (IMET)“ das Wirtschaften der Aristokratie als bisher unterrepräsentierten Aspekt der Adelsforschung. Sie nimmt also die damalige politische Elite auch in ihrer Bedeutung für das Wirtschaftsleben in den Blick. „Traditionell beschäftigt Adelsforschung sich mit der Repräsentation, also der Ausgabenseite, oder wirft ein Schlaglicht auf einzelne Familien. Ich bemühe mich um eine strukturelle Analyse der Einnahmenseite – also woher das Geld kam – und der wirtschaftlichen Rolle des Adels für die Habsburgermonarchie zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert“, erläutert die Historikerin.
Nicht der eine Kassenzettel für das protzige Kleid ist für sie interessant, sondern eine möglichst vollständige Buchführung und Korrespondenz sind es. Von Einzelpersonen und anekdotischen Analysen will sie hin zur Erfassung der Gesellschaftsschicht als Gruppe. Die Datenerhebung in Wien, Prag, Klagenfurt und Brüssel hat sie bereits abgeschlossen und zehn Familien in ihr Sample aufgenommen. Es zeigt sich, dass Adelige in der Monarchie in diversen Branchen aktiv waren und Strukturen für Protoindustrie, Handel, aber auch Tourismus und Bankwesen mit aufbauten.
Disparate Archive – geografische Regionen
Hyden-Hanscho durchforstete in Tschechien, Belgien und Österreich zum Teil aufgeteilte, sowohl private als auch öffentlich zugängliche Herrschafts- und Familienarchive – oder ließ sie durchforsten –, um aussagekräftige Unterlagen über Güterverwaltung, Ämter, Produktionsstätten und Grundbesitz zu sammeln. Für das Elise-Richter-Projekt hat sie einige Familien aus den damals wirtschaftlich starken und früh industrialisierten böhmisch-österreichischen Kernländern ausgewählt, die untereinander Heiratsnetzwerke pflegten und den Großteil des Wiener Hofadels stellten. Teil der Untersuchung sind aber auch Familien aus dem Herzogtum Kärnten, die in der Montanindustrie tätig waren, und einige aus der wirtschaftlich fortschrittlichen Provinz der Österreichischen Niederlande (heutiges Belgien/Luxemburg), fernab von Wien.
Leihʼ mir was, dann gebʼ ich dir was
Durch ihre umfangreichen Untersuchungen kann die Historikerin belegen, dass Adelsfamilien seit der frühen Neuzeit wesentlich in den Aufbau eines funktionierenden Zahlungsverkehrs und Privatkreditsystems involviert waren. Grundbesitz war schon damals als Sicherheit anerkannt und schuf so die Ausgangssituation, um Geld zu verleihen: an andere Adelige, an Untertanen, aber auch an den Herrscher. Man vergab Obligationen, eine Art Kreditvertrag mit vereinbarten Zinsen, und sorgte so dafür, dass Geld im Land und Staat zirkulierte. „Man konnte mit Geld viel Geld machen. Es wurden Minibeträge bis Riesensummen vergeben: dem Kaiser ein Vorschuss zur Kriegsfinanzierung über Staatsanleihen, anderen Adeligen für Käufe, Transaktionen oder Mitgiften. Dieses Kreditnetzwerk wurde bisher komplett übersehen“, so Hyden-Hanscho. Das Aushelfen mit Geld diente auch dazu, (lukrative) Ämter im Staat und am Hof in die eigene Familie zu holen. Ähnlich funktionierte die Vergabe von Lehen – so hatte die Familie Paar aus der Steiermark einige Zeit das Postwesen zum Lehen. Der Adel vertrat in der Grundherrschaft die Herrschenden. An den Besitz von Grund und Boden wurden Steuereinhebung und Verwaltung gekoppelt, die Adelsfamilien mussten Verwaltungsstrukturen wie die Patrimonialgerichtsbarkeit und Finanzverwaltung, später auch Schulen unterhalten. Je größer und zusammenhängender eine Grundherrschaft war, desto kostendeckender arbeitete die grundherrschaftliche Verwaltung – wie etwa in Böhmen. Bei kleinen und zersplitterten Besitzverhältnissen, etwa im Alpenraum, war die Rentabilität zunehmend in Frage gestellt.

Landwirtschaft, Industrie, Bergbau & ein Spa
Neben Geldverleih als Einkommensquelle gab es die traditionelle Bewirtschaftung von Grund und Boden, denn mit dem Besitz ging das Recht auf Ausbeutung der Rohstoffe einher: in Form von Landwirtschaft, wobei vor allem in Böhmen große Flächen bewirtschaftet werden konnten, oder Almwirtschaft in alpinen Lagen. In den Österreichischen Niederlanden betrieb die Familie Arenberg auf Poldern, also auf den dem Meer durch Deiche abgerungenen Flächen, intensive Landwirtschaft. Auch Montanindustrie, sprich Bergbau samt spezialisierter Weiterverarbeitung, war eine Einnahmequelle, etwa für die Familie Lodron in Kärnten. Textilmanufakturen (Leinen, Wolle, Mischgewebe) wurden in Böhmen von zahlreichen Familien betrieben, die bekannteste davon war die Familie Waldstein. Die traditionell in Heimarbeit gewobene und gesponnene Ware wurde zur zentralen Weiterverarbeitung in Manufakturen und protoindustrielle Fertigungskomplexe transportiert. Eine Familie in Böhmen hatte Ende des 18. Jahrhunderts bereits eine Bäderwirtschaft, also den Vorläufer einer Tourismusinfrastruktur, in Betrieb.
Erfolgsfaktoren für adelige Unternehmer:innen
Eine verbreitete Annahme kann Veronika Hyden-Hanscho mit ihren Recherchen bereits entkräften: Der Adelsrang ging durch kommerzielle Betätigung definitiv nicht verloren. Ab dem 18. Jahrhundert investierten Adelige auch in Handelsgesellschaften oder den Aufbau von Banken. Gearbeitet haben immer die Untertan:innen, aber wirtschaftlich erfolgreiche Familien eigneten sich definitiv Fachwissen an und waren in die Geschäftstätigkeit involviert, etwa die Ankurbelung des Vertriebs oder mit gezielten Instruktionen für den Manufakturbetrieb. Man ließ nicht nur arbeiten, sondern traf bewusste Entscheidungen.
Die Unterschiede zwischen bürgerlichen und adeligen Betrieben, wirtschaftlichem Erfolg oder Misserfolg macht die Adelsforscherin nicht ausschließlich am Zugang zu Arbeitskräften fest. Die grunduntertänige Arbeit, die unbezahlte „Robot“, konnte auch in Betrieben abgeleistet werden, für Handarbeit oder Transporte. Für Facharbeit musste aber jedenfalls bezahlt werden und auch protoindustrielle Fertigungen im Verlagssystem wurden handelsüblich bezahlt. Hyden-Hanscho dazu: „Der Adel hatte Zugang und Anrecht auf solche Dienste, aber das war kein echter Standortvorteil. Eher die Gesamtheit an Ressourcen einer Grundherrschaft wie Boden, Rechte und Untertan:innen oder Wirtschaftsförderungen, zunächst über Privilegien, seit Maria Theresia in Form billiger Kredite, über die in Gremien entschieden wurde, in denen Adelige vertreten waren.“ Auch die Heiratspolitik zählte zu den Startvorteilen, wenn Ländereien vereint werden konnten. Solche Besitzheiraten gab es aber auch im Bürgertum.
Die Einnahmenseite beschreiben
In einer ständischen Gesellschaft ist Ungleichheit die Norm. Der Adel hatte in dieser ungleichen Gesellschaft Startvorteile im Grundbesitz, in der Heiratspolitik und den Ämtern, aber die Arbeitsbedingungen der einfachen Bevölkerung waren in allen Wirtschaftsbetrieben gleich schlecht. Ihre Forschungsergebnisse hält Hyden-Hanscho in einer Monografie fest, die Anfang 2025 erscheinen soll. Darin wird erstmals zu lesen sein, wie sich das adelige Einkommen zusammensetzte, und es werden die Erkenntnisse zu Kreditwesen, Protoindustrien, Güterwirtschaft, aber auch Schuldenmanagement und Konkursen präsentiert. Auch Adelige konnten trotz aller Privilegien Bankrott gehen oder eben Schlösser, Prunk und Gloria bezahlen.
Zur Person
Veronika Hyden-Hanscho studierte Geschichte und Deutsche Philologie in Graz und Poitiers und promovierte 2011 mit einer Arbeit, die aus dem FWF-finanzierten Forschungsprojekt „Kulturtransfer vom Südatlantik nach Zentraleuropa, 1640–1740“ resultierte. Sie war von 2011 bis 2013 Österreich-Lektorin an der Universität Wrocław (Polen) und von 2013 bis 2017 Projektmitarbeiterin am Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung der Akademie der Wissenschaften. Derzeit ist sie Elise-Richter-Stelleninhaberin am Institute for Habsburg and Balkan Studies (IHB) der ÖAW. Im Herbst 2021 war sie Gastforscherin der Universität Gent (Belgien). Ihre Spezialgebiete sind Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Kulturgeschichte, Adelsforschung, Soziale Netzwerkanalyse und Fiscal-Military-State-Forschung insbesondere in der Habsburgermonarchie.
Publikationen
Hyden-Hanscho, Veronika: Habsburg War Finance and Noble Credit-Brokerage in the Southern Netherlands under Charles VI, in: William D. Godsey und Petr Mat’a (Hg.): The Habsburg Monarchy as a Fiscal-Military State. Contours and Perspectives 1648–1815, Proceedings of the British Academy 247, Oxford University Press 2022, S. 249–266
Hyden-Hanscho, Veronika: State services, fortuitous marriages and conspiracies: Trans-territorial family strategies between Madrid, Brussels and Vienna in the seventeenth and eighteenth centuries, in: Journal of Modern European History 2020
Godsey, William D., Hyden-Hanscho, Veronika (Hg.): Das Haus Arenberg und die Habsburgermonarchie. Eine transterritoriale Adelsfamilie zwischen Fürstendienst und Eigenständigkeit (16.–20. Jahrhundert), Schnell & Steiner 2019