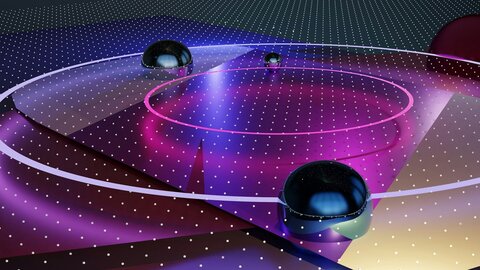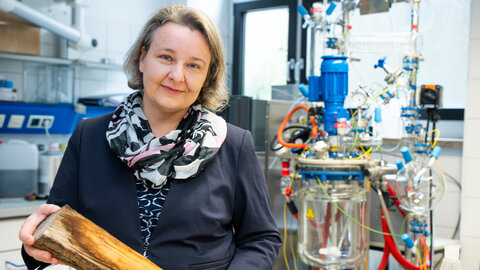Kängurus und Kirschblüten

Von Christoph Aistleitner
Von 2012 bis 2015 verbrachte ich als FWF-Schrödinger-Stipendiat das erste Jahr an der University of New South Wales in Sydney, Australien. Das zweite Jahr absolvierte ich an der Universität Kobe in Japan, und schließlich folgte das sogenannte „Rückkehrjahr“ an der Universität Linz. Ich bin Mathematiker und immer wieder begeistert davon, wie sehr diese Wissenschaftsdisziplin für internationale Kooperation geeignet ist: Zwei Mathematiker, gleich welcher Nationalität, brauchen nicht mehr als ein Blatt Papier und einen Stift, um an praktisch jedem Ort der Welt miteinander arbeiten zu können. Der direkte persönliche Kontakt ist dabei von herausragender Bedeutung: Kooperation per E-Mail oder Skype ist zwar theoretisch möglich, aber in Wahrheit unerträglich öde. Direkte Kooperation hingegen kann mitreißend sein –, wenn auch oft unterbrochen von tage- oder wochenlangen Pausen, in denen sich das neu Gedachte erst „setzen“ muss, bevor dann auf gefestigter Basis ein weiterer Fortschritt möglich ist.
Wissenschafter und ihre Reiseziele
Wissenschafter sind Menschen – das klingt banal, wird aber im Wissenschaftsbetrieb von offizieller Seite allzu oft vergessen oder soll zumindest gegenüber „höheren“ dienstlichen Interessen in den Hintergrund treten. Ich hatte zum Zeitpunkt der Beantragung meines Schrödinger-Stipendiums zwei Neugeborene (Zwillinge), und musste also bei der Abfassung des Antrags nicht nur überlegen, an welchen Orten eine fruchtbare wissenschaftliche Kooperation zu erwarten ist, sondern auch daran, wo meine Familie eine interessante und angenehme Zeit verbringen kann - unter Berücksichtigung der medizinischen Versorgung, der Lebensqualität, und – darf man es laut sagen? – auch unter Berücksichtigung des touristischen „Mehrwertes“. Die Entscheidung fiel auf Australien und Japan – beides Länder mit hoher Lebensqualität und sicherer medizinischer Versorgung, und obendrein beide so interessant und exotisch, dass es zweifellos lohnt, dort ein Jahr zu verbringen. Ach ja, ich hatte auch hervorragend geeignete potenzielle Kooperationspartner in beiden Ländern.
Mühen des Alltags
Bei der Anreise nach Australien waren meine Kinder gerade ein Jahr alt. – Die gesamte Reisezeit dauerte, mit diversen Verspätungen und Unterbrechungen, ziemlich genau 54 Stunden. Vor Ort in Australien dann Jetlag, Erkältungen, Wohnungssuche und in weiterer Folge: Haushalt einrichten, Handy und Internet und Bankkonto einrichten, Gitterbetten aufstellen, Kinderwagen organisieren und noch hundert andere Dinge. Dann kam der Umzug nach Japan, und damit wieder alles von vorn. Ich erinnere mich, dass ich einige Wochen nach der Ankunft in Australien mit meiner Frau abends müde zuhause saß und wir kopfschüttelnd sagten: Wird der Zeitpunkt kommen, an dem wir an diese Zeit zurückdenken werden und sie so weit verklärt haben, dass wir sie als schön in Erinnerung haben werden? Ja, er kam bereits, und es ist tatsächlich so: Wenn ich an meine Auslandsjahre denke, denke ich nicht an Mühsal und organisatorischen Wirrwarr, sondern daran wie man morgens aus der Haustür geht, und vor strahlend blauem Himmel die Papageien in verschiedensten Farben fliegen sieht, untermalt vom Geschrei der Kakadus.
Wunderbare Momente
Ich denke an die Freiheit, an einem schönen Tag nicht ins Büro, sondern an den Strand zu gehen, und dann eben an einem Regentag ins Büro. Die gewaltigen Flughunde in Australien, die abends durch die Dämmerung kreisten. Grillstationen in den Parks, an denen man kostenlos das mitgebrachte Fleisch grillen konnte. Oder in Japan die Kirschblüten-Woche, wenn die ganze Stadt wie in Watte gepackt ist, so wie hierzulande nach frisch gefallenem Schnee. Die ständigen Feste, die einen unvorbereitet treffen und deren Bedeutung man nicht versteht: Alle Menschen tragen geschmückte Besen, an jeder Hausecke liegt ein Häuflein Salz, durch die Straßen werden turmhohe Holzwagen gezogen. Supermärkte, durch die man lange irren könnte, ohne zwischen getrockneten Fischen und Algen irgendetwas zu finden, das man als Nahrungsmittel eindeutig identifizieren könnte – und wie oft stellt sich dann zuhause heraus, dass man etwas völlig anderes gekauft hat als gedacht. Das war Alltag, nicht Urlaub – und Urlaub gab es natürlich auch.
Bleibende Erinnerungen
Urlaub bedeutete, auf einer staubigen Straße bei Canberra, mit dutzenden Kängurus fast in Griffweite vor den Autofenstern zu sein. Im Zug entlang der neuseeländischen Küste zu fahren, hundert Kilometer direkt am Strand im offenen Aussichtswagen, davon viele Kilometer weit den Gestank eines gewaltigen verrottenden Wals in der Nase. Oder morgens erwachen im Ryokan, einem traditionellen japanischen Hotel, mit dem Geruch der Reisstrohmatten, die den Boden bedecken, und den Blick über den Kawaguchi-See auf den Fuji-Berg in der strahlenden Morgensonne, davor die kunstvoll geschnittenen Bäumchen von frischem Schnee bedeckt. Oder an einem lauen Sommerabend auf der Fähre in der japanischen Inlandssee, mit einer Flasche Sake in der Abendsonne durch die Insellandschaft zu gleiten. – Pardon, ich habe mich hinreißen lassen – wieder einmal. Ja, gearbeitet habe ich auch, recht erfolgreich übrigens.