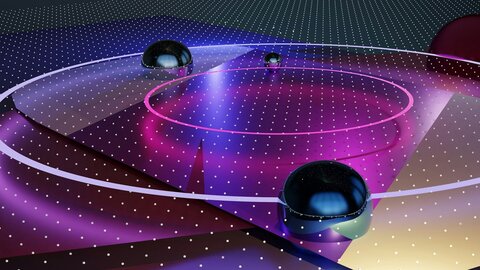Gemeinsam grooven für mehr Zusammenhalt

„Wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Böse Menschen haben keine Lieder.“ – Das Sprichwort fasst ein zentrales Thema von Dan Bowlings Forschung zusammen. Um die Lebensweisheit zu einer Kurzfassung der sogenannten Synchronity & Sociality-Hypothese zu erweitern, sei ergänzt: Wer gemeinsam wippt, sitzt, musiziert oder singt, stimmt sich auch im Verhalten gut ab, was zu mehr Verbundenheit und sozialem Verhalten in der Gruppe führt. Zu sozialem Verhalten gehört beispielsweise einander mögen, einander vertrauen oder miteinander kooperieren wollen. Ein gemeinsamer Rhythmus könnte helfen, sich in der Gruppe zu synchronisieren, also abzustimmen, was letztlich weniger sozialen Stress bedeutet. Der Neurobiologe Dan Bowling will diese Hypothese, unterstützt vom Wissenschaftsfonds FWF, mit unbestechlicher Methodik prüfen: „Es gibt vermehrt Hinweise darauf, dass Menschen die einzigen Lebewesen sind, die spontan ein seltsames Verhalten zeigen: Wenn sie ein regelmäßig wiederkehrendes Rhythmus-Muster hören, wippen oder klopfen sie nach einiger Zeit mit. Es stellt sich also die Frage, warum Musik so einen starken Effekt auf den Menschen hat.“
Was macht Musik mit dem Körper?
Wie man an Kindern beobachten kann, scheint Bewegung zu rhythmisch-musikalischen Mustern in der menschlichen Biologie tief verwurzelt zu sein. Zudem war, vor der Erfindung des Grammophons, Musikgenuss oder Tanz meist ein Gemeinschaftserlebnis. Dan Bowling will dieses zutiefst menschliche Verhalten, also das Bedürfnis, sich zu Musik synchron zu bewegen, im Körper nachweisen. Die Maßeinheit für das Mitreißende in Musik, das uns anregt uns passend zu bewegen, ist der „Groove“. In bisherigen Versuchen zu Rhythmus und Synchronie wurde meist gemeinsam „gegroovt“ und die Menschen im Anschluss befragt, wie sie sich fühlen und wie gut sie mit den anderen Gruppenmitgliedern können. Ein ziemlich schwacher Maßstab für so eine zentrale Frage, findet der Postdoktorand am Department für Kognitionsbiologie der Universität Wien. Er will die Macht der Musik anhand psychophysiologischer Parameter wie Pupillenerweiterung, Puls oder Atemfrequenz sowie am Hormonstatus festmachen.
Wie reißt der Groove uns vom Hocker?
Unterstützt vom FWF führen Dan Bowling und sein Team im Rahmen eines Lise-Meitner-Stipendiums seit 2015 verschiedene Experimente am „Rhythm and Movement Lab“ durch. In einer Versuchsreihe bekamen 32 Personen (50:50 Frauen und Männer) Musikstücke vorgespielt, die – wissenschaftlich belegt und getestet –, als „sehr groovig“ oder „wenig groovig“ eingestuft wurden. Verändert wurde die Musik von beiden Enden der Groove-Skala für die Versuche in Tempo und Lautstärke. Gemessen wurde die Veränderung der Pupillengröße bei den Probandinnen und Probanden, wobei die unwillkürliche Erweiterung als untrügliches Zeichen für Erregung beziehungsweise Anregung gilt.

Der Groove-Wert der Musik liegt – so lassen die Ergebnisse vermuten – in der gesamten Struktur, nicht nur in Tempo und Lautstärke. Im zweiten Durchgang wurde ausschließlich sehr groovige Musik gespielt und die Bass-Frequenzen betont oder vermindert. Mit überraschenden Ergebnissen: „Gemeinhin wird angenommen, dass der Bass das stimulierende Element ist. Wir konnten feststellen, dass Menschen stärker auf die höheren Frequenzen reagieren als auf verstärkte Bass-Frequenzen. Die gesamte Bandbreite zu hören – von Treble bis Bass –, hilft vermutlich das Taktmuster präzise wahrzunehmen, um letztlich mitzumachen“, sagt Bowling im Gespräch mit scilog. Im dritten Setting wurde mit Synkopen gearbeitet, die einen Taktschlag gleichsam vorankündigen. Die Synkopen wurden gleich oder veränderlich gesetzt. Aus den Daten liest der Neurobiologe ab, dass Synkopen dabei helfen, Vorhersagen über das Rhythmus-Muster zu treffen. Wer weiß, was kommt, kann Bewegungen antizipieren und noch besser abstimmen.
Im Chor singen, reduziert Stress
Um die Wirkungen von Musik in der Gruppe zu untersuchen, wurde ein 90-köpfiger Jugendchor begleitet und in Speichelproben das Stresshormon Cortisol gemessen. Verglichen wurden Subgruppen mit den Aufgaben Singen und Vorlesen und zwar alleine oder in der Gruppe. Eine Abnahme des Stresshormons konnte für alle Aktivitäten nachgewiesen werden. Da aber noch nicht alle Daten ausgewertet sind, könnte sich zudem noch ein positiver Gruppen-Effekt zeigen. Was sich aber jetzt schon herauslesen lässt: Singen senkt den Cortisol-Spiegel stärker als Lesen. Und Männer erleben eine stärkere Cortisol-Reduktion als Frauen. Das Team testete die Speichelproben auch auf das Hormon Oxytocin – medial oft zum Kuschelhormon verkürzt –, das den Zusammenhalt fördern soll. Oxytocin hat nachweislich biologische Funktionen in Mutterschaft und Paarbindung. Aber bei den Chormitgliedern zeigte sich keine Zunahme des Hormons im Speichel: „Es ist wohl komplizierter, als wir denken. In unseren Versuchen konnten wir eine Abnahme des Oxytocin-Levels feststellen. Der Zusammenhalt mit gleich 89 anderen Chormitgliedern lässt sich wohl nicht nur auf ein Hormon zurückführen“, resümiert Bowling.
Zur Person Dan Bowling studierte Psychologie, Kognitionswissenschaft und Philosophie an der University of California San Diego und absolvierte sein Doktorat in Neurobiologie an der Duke University (North Carolina). Seit 2012 ist er Postdoc in der Arbeitsgruppe von Tecumseh Fitch am Department für Kognitionsbiologie an der Universität Wien. Am „Rhythm and Movement Lab“ arbeitet er zu Kognitionswissenschaft, experimenteller Psychologie und Evolutionsbiologie mit Fokus auf Stimmbildung/Hörwahrnehmung und Musik.
Publikationen