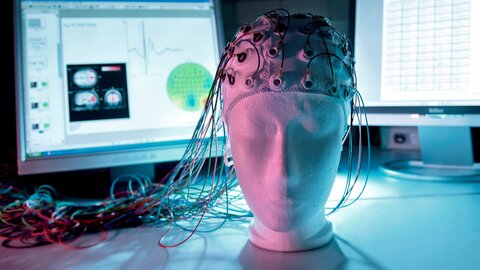Die Genetik des Suizidrisikos

Suizid ist ein weitgehend tabuisiertes Thema. Doch das freiwillige Ausscheiden aus dem Leben trifft Angehörige besonders hart und wird von vielen Fragezeichen begleitet. Weltweit nehmen sich rund 800.000 Menschen pro Jahr das Leben, davon zuletzt rund 1.200 in Österreich (Stand 2016). Suizidversuche dürften diese Zahlen laut Schätzungen um das 10- bis 30-Fache übersteigen. Doch woran lässt sich Suizidrisiko ablesen, wie kann es rechtzeitig erkannt und präventiv gehandelt werden? Die Forschung geht diesen Fragen unter anderem im Zusammenhang mit einer der am häufigsten vorkommenden sogenannten affektiven Störung nach, der Depression. Diese steht häufig mit Suizidgedanken oder -versuchen in Verbindung. Dass Depression auch genetische Ursachen haben kann, ist heute eindeutig belegt. Und inzwischen hat die Forschung auch für Suizidgefährdung Spuren im Gehirn Betroffener gefunden. Doch noch sind viele Fragen offen, besonders was die Wechselwirkung von biologischen und Umweltfaktoren betrifft. Ein Forscherteam um die Medizinerin Alexandra Schosser von der Medizinischen Universität Wien ist gezielt der Frage nach den Wechselwirkungen nachgegangen und hat untersucht, wie sich Biomarker für das Risiko, sich das Leben zu nehmen, von jenen einer Depression unterscheiden, sprich, ob es tatsächlich eigene genetische Spuren für Suizid gibt.
Die Linie zwischen Depression und Suizid
In einer klinischen Studie haben die Wissenschafterinnen und Wissenschafter das Genom von 846 Patientinnen und Patienten mit Depression (80 Prozent) oder einer anderen affektiven Störung untersucht. Im Gegensatz zu bisherigen Untersuchungen wurde das Suizid-Verhalten aber nicht mit gesunden Menschen verglichen, sondern mit den Daten der Patientengruppe, um mögliche Gene zu identifizieren, die sich von denen affektiver Störungen unterscheiden. Neben dieser genetischen Analyse wurden auch epigenetische Faktoren und Umwelteinflüsse in die Untersuchung einbezogen. So haben Schosser und ihr Team in umfangreichen diagnostischen Interviews das Ausmaß des Suizidrisikos und der eigentlichen Suizidgefahr erhoben, um das Zusammenwirken von Erbanlagen und Umweltfaktoren besser zu verstehen.
Traumatische Kindheit erhöht Risiko bei Frauen
Unter anderem untersuchten die Forschenden den Einfluss von Kindheitstraumata auf Suizidversuche und stellten bei Frauen, nicht jedoch bei Männern, einen signifikanten Zusammenhang fest. Demnach führen traumatische Erlebnisse in der Kindheit bei Frauen vermehrt zu Suizidversuchen und selbstverletzendem Verhalten. „Unsere Hypothese, dass Betroffene von Kindheitstraumata ein erhöhtes Suizidrisiko haben, hat sich bestätigt“, berichtet Alexandra Schosser. „Wir haben sowohl einzelne Genotypen gefunden, die in Zusammenhang mit Suizidversuchen stehen als auch epigenetische Veränderungen. So ergaben die Genanalysen, dass das COMT-Gen, das unter anderem den Neurotransmitter Dopamin beeinflusst, in Zusammenhang mit Suizidversuchen steht und sich nachweislich auf das Ausmaß von Suizidrisiko auswirkt. Bei Frauen mit Suizidgedanken verminderte sich die Aktivität von COMT, während der Oxytocin-Level anstieg.
Vielversprechende Einsichten
Einen weiteren Hinweis im Zusammenhang von traumatischer Kindheit und Suizidversuchen fanden die Forscherinnen und Forscher in einem Gen (CRHR1) der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse (HPA-Achse), die in die Entstehung von affektiven Erkrankungen involviert ist. „Wir haben in der Studie vielversprechende Einsichten gewonnen in die genetische Prädisposition für suizidales Verhalten“, fasst Alexandra Schosser zusammen. Auch protektive Genotpyen für Suizidversuche wurden laut der Projektleiterin im Rahmen der Analysen gefunden. Die Psychiaterin und Psychotherapeutin betont, wie wichtig gerade bei psychischen Erkrankungen auch das Wissen über biologische Faktoren ist, da dies Betroffenen mehr Klarheit geben und helfen kann, Stigmatisierungen abzubauen. Psychische Erkrankungen werden wie andere Krankheiten durch Gene und die Umwelt beeinflusst. Durch die Genanalysen erhofft sich die Suizidforschung neue Ansatzpunkte für Therapien. Zudem könnte es künftig in der klinischen Praxis beispielsweise möglich werden, Hochrisikopatientinnen und -patienten zu identifizieren und entsprechende präventive Maßnahmen einzuleiten. Für die Forschung gibt es noch viele Fragen, besonders zu epigenetischen Veränderungen, wie Schosser betont. Sie will in einem Nachfolgeprojekt die Patientendaten weiter auswerten und durch einen ausführlichen Evaluationsprozess gemeinsam mit den Betroffenen auch Langzeitdaten erheben.
Zur Person Alexandra Schosser ist Psychiaterin und Psychotherapeutin. Sie führte die „Wiener Studie zur Genetik von Suizidalität bei affektiven Erkrankungen“ mit Unterstützung des FWF an der Medizinischen Universität Wien durch (2012-2018). Neben Tätigkeiten in Forschung und Lehre leitet Schosser die Zentren für seelische Gesundheit BBRZ-Med in Wien.
Publikationen